Aus vergilbten Blättern
Aus vergilbten Blättern - Archiv
Wir wollen Ihnen die Geschichte Pankows näher bringen. Dazu veröffentlichen wir die Ortschronik Aus vergilbten Blättern von Ferdinand Beier aus dem Jahr 1922. Was Sie bisher lesen konnten, finden Sie hier:
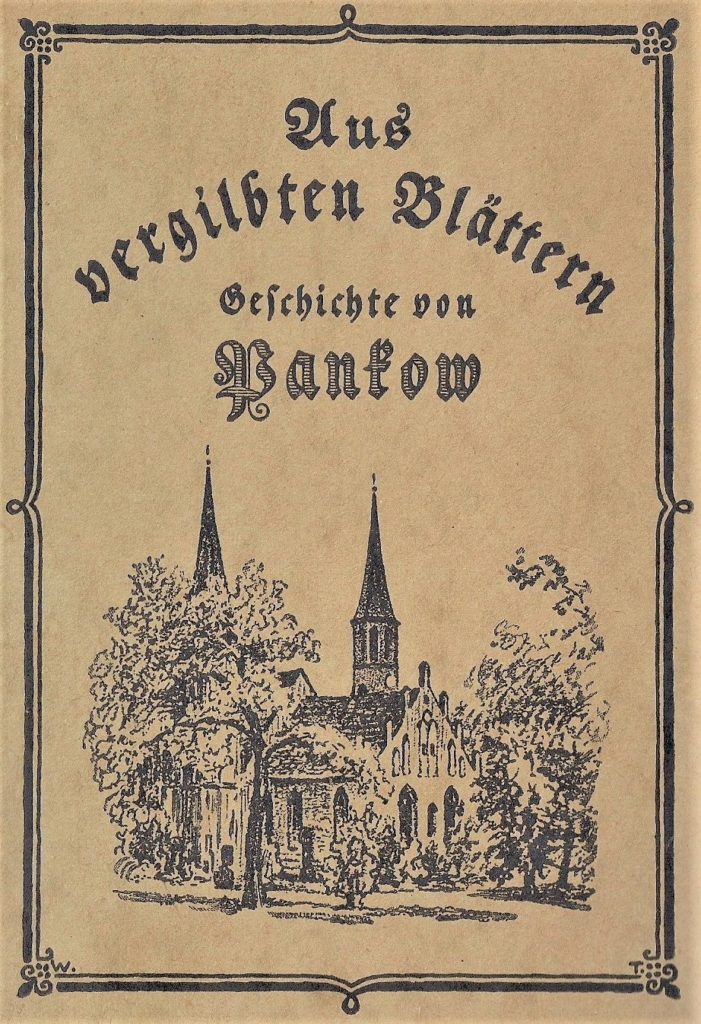
Folge 1
Vorbemerkung: Der Bezirk Pankow ist heute nicht nur fester Bestandteil der Metropole Berlin, er ist auch liebenswerter Ort für die in ihm lebenden Menschen. Dabei kann Pankow schon auf eine lange spannende Geschichte zurückblicken. Einer der sie vor rund 100 Jahren zu erzählen begonnen hat, war der Pankower Pastor, Superintendent und Amateur-Historiker Ferdinand Beier (1890 Pfarrer, 1911 Superintendent). Seine Ortschronik „Aus vergilbten Blättern“ wollen wir unseren Lesern künftig an dieser Stelle nahebringe. Beiers Bericht beginnt im frühen Mittelalter:
Die Zeit vor 1200.
Die Erforschung der Geschichte unseres Ortes führt uns in weit vergangene Jahrhunderte zurück. Pankow verdankt seinen Ursprung nicht den Hohenzollern oder den Markgrafen aus dem Luxemburgischen oder Wittelsbacher oder Anhaltinischen Hause. Es ist ein altes wendisches Dorf, wenn auch die charakteristische Bauart dieser Dörfer, die Hufeisenform, der runde Kreis mit nur einer Einfahrt und dem freien Platz in der Mitte, sich nicht mehr erkennen läßt. Die stürme der Kriege und Verheerungen, welche über unseren Ort dahingegangen sind, haben die alte Form des Dorfes zerbrochen. Neue Bewohner aus einem anderen Volk bauten nach anderer Art und nach ihrem Willen sich die Wohnstätten.
Folge 2
Deutschen Klang haben die Namen der Dörfer rings um Pankow, aber unser Ort und noch etwa 30 Dörfer im Kreise Niederbarnim tragen wendische Namen und erinnern uns daran, daß wir im alten Wendenlande wohnen, welches erst nach schweren Kämpfen dem Christentum erlag. Bis auf wenige Wörter im Sprachschatz unseres Volkes ist das Wendische in unserer Gegend ausgewischt, aber der alte wendische Name Pankow ist unserem Orte geblieben; er ist ein sicheres Zeugnis, daß hier einst ein Wendendorf „Pankow“ war.
Was bedeutet der Ortsname. Die einen leiten ihn von kow oder kowo „Wald“ her und und sehen in der Silbe Pan die wendische Bezeichnung für „Gottheit“, also „heiliger Wald“. Andere meinen, „kow“ oder „kowo“ heiße Sitz und „Pan“ bedeute „Herr“, also „Herrensitz“, was darauf schließen ließe, daß hier einst ein wendischer Herr seinen Sitz hatte. Nicolai übersetzt in seiner Beschreibung „Berlin und Potsdam“ Pankow sogar mit „Haselnußschale“. So schön auch die Deutungen des Namens klingen, sie sind doch unrichtig. Der Name „Pankow“ ist offenbar abgeleitet vom Flußnamen Panke oder Pankowe, an welcher unser Ort liegt. Der Name Panke hat wiederum auf Gottheit oder Herr keine Beziehung. Man nannte diejenigen Flüsse Panke, welche nicht im gleichmäßigen Bett dahinfließen, sondern bald in Seen und Sümpfen verschwinden, bald klar und schnell dahinfließen. Auch im Slavischen heißt ponikwa (panke) „Fluß mit Strudeln“.
Daß gerade hier schon früh eine Niederlassung sich befand, ist kaum zu verwundern. Da die Wenden nicht wie die alten Germanen auf getrennten Höfen, von ihren Aeckern umgeben, vereinzelt lebten, sondern zu Gemeinschaften vereint Dörfer bildeten, so war es natürlich, daß sie in ihrer Liebe zum Ackerbau und zur Fischerei auch an dem damals breiten, durch Waldsümpfe seinen Weg sich bahnenden Pankefluß mit seinem in jenen Jahren klaren, schnellfließenden Wasser und seinem Reichtum an Fischen sich niederließen. Meilenweit erstreckten sich um Pankow die Wälder, in denen sie sich kundig zurechtfanden. In diesen Wäldern konnten sie sich vor Feinden verbergen; eine Stunde abwärts der Panke im schnellen Lauf und sie waren im Spreetal; weiter die Spree entlang ging es zum Haveltal.
Folge 3
So konnten sie, kundig aller Wege, stets gedeckt vor Verfolgern, ihre mächtigen Hauptstadte Brennaborg und Havelberg, ihre Opferstätten und Sammelorte in Kriegszeiten, erreichen. Den aufsteigenden Rauch ihrer Feuerstätten verdeckte nordwärts der hohe Wald mit seinen rauschenden Eichenkronen und den dunklen Kiefernwipfeln, und südwärts lehnten sich ihre Aecker an den breiten Höhenrücken, welcher das Panketal vom Spreetal trennte, auf dessen lehmigen, fruchtbaren Boden sie ihre Halmfrüchte bauten. Von diesem Höhenzug – heute etwa die Gegend der Kaiser-Friedrich-Straße bis hin zum alten Berliner Windmühlenberg – konnte das Auge das Spreetal überschauen, welches etwa 100 Meter tiefer lag. Die alten Eichen unseres Schloßparks, deren einige ein Alter bis tausend Jahre haben, und die wenigen alten Kiefern sind wohl noch ein Rest des wunderbaren einstigen Waldes und erzählen in ihrem Rauschen vom alten Wendenleben, das sie einst geschaut und geschützt haben. Bis in die Neuzeit hinein hat sich in den Grundbüchern der Name „das große Eichholz“ erhalten. Hier lebten die ersten Bewohner unseres Ortes günstig und sicher und dienten dem Belbog (weiß = Licht, Sonne), dem Gott des Lichtes und des Guten, und dem Zernebog (schwarz), dem Gott des Dunklen und des Bösen.
Wann hier der erste Ansiedler seine Heimstatt erbaute, meldet uns kein Geschichtsblatt. Man hat Reste einer heidnischen Opferstätte hier nicht gefunden, worin freilich kein Beweis liegt, daß eine Opferstätte überhaupt nicht im Orte war. Die christliche Mission hat die Opferstätten fast immer zertrümmert und an derselben Stelle die Kirche erbaut, an deren Eingang die Opfersteine, soweit sie nicht zum Bau verwandt waren, vergraben wurden.
Wie kam es, daß das alte Wendendorf ausstarb und unterging?
Die Wenden waren kriegerisch und liebten es, in das Sachsenland räuberische Einfälle zu machen.
Heinrich I. schlug sie 927, ging über die Elbe und nahm 928 mit Hunger und Schwert die feste Wendenstadt Brennaborg (Brandenburg) ein.
Folge 4
Durch den Fall dieser Stadt wurde das Wendenland zwischen Elbe, Havel und Spree wehrlos und fiel in die deutsche Hand. Heinrich schuf hier die Nordmark, welche der Anfang des preußischen Staates geworden ist. Nachdem die Wenden 983 noch einmal den Teil der Nordmark östlich der Elbe vorübergehend wiedererobert hatten, unterlagen sie zuletzt den Anhaltinern, welche vom Kaiser Lothar mit der Nordmark belehnt, mit dauerndem Erfolg den Kampf gegen die Wenden aufnahmen. Bei Salzwedel steht noch heute ein alter runder Turm, der Rest einer festen Burg; hier hatte Albrecht der Bär, seine Residenz, und von hier aus unterwarf er noch einmal 1134 die alte Nordmark. 1136 erkämpfte er die Priegnitz, das Land nördlich der Havel. Das südliche Havelland ererbte Albrecht vom Wendenfürsten Pribislaw. Welcher Christ geworden war, mußte sich das ererbte Land jedoch erst mit dem Schwert erobern. Albrecht nahm 1156 Brennaborg, verjagte den Wendenfürsten Jazzo, verlegte seine Residenz nach Brennaborg, nahm den Titel „Markgraf von Brandenburg“ an und nannte das Land zwischen Elbe, Havel und Spree nun „Neumark“.
In diesen Kriegen und besonders in dem umfassenden letzten Aufstand unter Jazzo fanden die Wenden ihren Untergang. Das Wendenland war völlig verwüstet. Die Dörfer lagen verödet und verbrannt. Wir können auch von unserem Ort Pankow annehmen, daß in diesem Aufstand die Bewohner geflohen und die Wohnstätten zum Schutthaufen geworden waren.
1200 – 1370
Um das Jahr 1200 begann eine neue Kolonialisierung unserer Gegend. Von Sachsen her kamen Ansiedler, welche aber, der Bodenart der damals sumpfigen Mark unkundig, hier nicht seßhaft geworden sind. Niederländische und holländische Kolonisten, von Albrecht dem Bär „aus den Wasserlanden“ gerufen, folgten ihnen. Mönche vom Templer- und Johanniterorden, welche Albrecht von seiner Jerusalemsreise in das Land geführt hatte, halfen. Seine Söhne, Johann I. und Otto III., welche 1200 dem Vater in gemeinsamer Regierung gefolgt waren, setzten das Werk fort, bauten in den Dörfern Kirchen und dotierten dieselben mit Land, gewöhnlich 4 Hufen. Diese Markgrafen bedienten sich der Zisterziensermönche.
Ist damals schon unsere Kirche erbaut? Die Jahreszahl berichtet uns keine Chronik, aber da Johann I. und Otto III. die Kirche zu Pankow 1230 mit vier Hufen Land zur Besoldung des Pfarrers versehen haben, da ferner die Apsis unserer Kirche die viereckige Form hat, welche den von seinen Mönchen erbauten Kirchen eigen ist, so können wir wohl annehmen, daß die Kirche um 1230 entstanden ist.
Doch bleiben wir noch einen Moment bei der Wiedererstehung unseres Ortes stehen. Albrecht der Bär nahm von dem durch Zerstörung der Dörfer und Flucht oder Tod der Bewohner frei gewordenen Land Besitz und bildete überall Rittergüter zur Belohnung treu ergebener Vasallen und freie Schulzengüter, denen Bauernstellen und Kossätenstellen angeschlossen wurden. Der Markgraf war in Brandenburg von Reichs wegen „die höchste und einzige Obrigkeit, oberster Richter, oberster Kriegsherr, Obereigentümer von Grund und Boden“. Wo noch Reste eines alten Dorfes waren, blieben die alten wendischen Ortsnamen. Dies war bei unserem und manchem anderen Ort der Fall (z. B. Schönfließ, Schowe (Rohr) flet (Bach). Es war dies eine kluge Rücksichtnahme auf die im Lande gebliebenen Wenden, welche nicht mit Gewalt vertrieben worden sind, sondern, sobald sie sich der neuen Regierung fügten, geschont wurden und in ihrem Besitz verblieben. Der erste Einwohner Pankows, Duczek, welcher uns in einer Urkunde 1355 begegnet, ist ein Wende, dessen Vorfahren vielleicht auf ihrem Hof hier im Ort schon zur Zeit der Wendenkriege gelebt haben. Neu entstandene Dörfer erhielten ihre Namen oft noch den belehnten Familien: Hermannsdorf (später Hermsdorf), Richardsdorf (später Rixdorf). Der Markgraf war Grundherr (dominus fundi) und Lehnsherr (dominus foedi) und belehnte mit den Gütern und Hofstellen; er bezog das Lehnsgeld, den Ackerzins (Grundsteuer) und den Zehnten von den Früchten und dem Vieh, auch von Gänsen, Hühnern und Eiern. Die ganze Feldmark, welche genau vermessen war, wurde einem „Locator“ (oft ein Unternehmer, wenn es ein neues Dorf war, oft ein Besitzer, welcher einen Hof schon besaß, oder ein zu belehnender Vasall) übergeben, welcher an Kolonisten die einzelnen Hofstellen und Ackerteile verkaufte oder verpachtete, den Kaufpreis einzog und die Ablieferung der Abgaben überwachte. Der Locator durfte niemals die ganze Feldmark selbst unter den Pflug nehmen, sondern erhielt für sich eine Anzahl abgabenfreier Hufen und eine Wiese. Die Verteilung des Ackers erfolgte nach „Hufen“ (lateinisch mansi). Grimm leitet dieses Wort von „Haben“ ab, eine Habe, ein Anteil, von dessen Ertrag der Bauer leben konnte. Daher war die Größe der Hufe auch unbestimmt und schwankte je nach der Güte des Ackers in den verschiedenen Gegenden zwischen 30 bis 150 Morgen, in Pankow etwa 33 Morgen. Der Vorstand des Dorfes war der Schulze oder Schultheiß, welcher mit dem Rittergut oder dem Schulzenhof belehnt wurde. Er hatte eine bedeutende Macht, übte das Richteramt im Dorfgericht und erhob alle Abgaben. Im Gegensatz zu den Bauern und Kossäten saß er zinsfrei auf seinen Hufen, mußte jedoch vom etwa zuerworbenen Land die gewöhnlichen Abgaben entrichten. Zu seinen Einkünften gehörte ein Drittel der Strafeinnahmen vom Dorfgericht sowie der Nießbrauch einer Wiese, wofür er wiederum verpflichtet war, einen Dorfbullen zu halten. Er war im Besitz des Krugrechtes; verpachtete er den Krug, so bezog er vom Pächter den Fleischzehnt und 2 alte Pfennige für jede Tonne Bier. Der einflußreichen Stellung als Dorfrichter und zinsfreier Besitzer entsprachen aber auch besondere Pflichten gegen den Landesherrn. Bei der Belehnung mit seinem Hof bezahlte er und jeder Nachfolger ein bestimmtes Lehnsgeld. Im Kriegsfall mußte er ein Lehnspferd stellen oder eine Geldgebühr, in alter Zeit 28 Groschen und 8 Pfennig, entrichten.
Folge 5
Auf beiden Seiten der Dorfstraße waren die Höfe der Bauern und Kossäten erbaut und an den Enden der Straße wohl auch manches Büdnerhäuschen. Die Bauern (mansuarii = Hufenbesitzer) hatten ihren anfangs durch den Locator vom Landesherrn erkauften Hof und Acker selten in erblichem, gewöhnlich in nicht erblichem Besitz, welchen sie verkaufen konnten, jedoch nicht ohne Genehmigung des Lehnsherrn. Ging der Hof durch Erbschaft oder Verkauf in andere Hände über, so mußte der neue Besitzer die Belehnung mit dem Hof bei der Kanzlei des Lehnsherrn nachsuchen; erst durch die Belehnung, welche mit einer Abgabe verbunden war, war der Uebergang des Besitzes abgeschlossen. Die Bauern entrichteten jährlich an den Markgrafen den Zehnten vom Getreide und Vieh und den Ackerzins. Gebrauchte der Landesherr Mittel zum Kriege, so bezahlten sie die Bede (Bitte, petitio), eine Abgabe, welche 1280 in eine bestimmte geringe Jahressteuer verwandelt wurde. Die Bauern waren ferner zum Spanndienst servitium curruum) verpflichtet, welchen sie dem Markgrafen mit Wagen und vier Pferden im Kriegsfall leisteten, dem Besitzer des Lehnsschulzengutes aber in jeder Woche an mehreren bestimmten Tagen. Im Gegensatz zu den Bauern hatten die Kossäten keinen Anteil am Dorfacker. Ihr Hof mit dem mehrere Morgen großen Garten war nicht erblich und konnte ihnen bei schlechter Wirtschaft sofort genommen werden. Sie entrichteten wie die Bauern an den Landesherrn das Kaufgeld, den Grundzins in Geld, vom Garten und Vieh den Zehnten, auch von Gänsen und Hühnern, und waren an mehreren Tagen zum Handdienst dem Lehnsschulzen verpflichtet. Die Kossäten waren bei ihrer geringen Einnahme vom Hof auf den Tagelohn bei den Bauern und dem Schulzen angewiesen. Die Büdner hatten nur ihr Häuschen, in welchem oft mehrere Familien wohnten, ohne Garten. Das Haus gehörte dem Brotherrn. An Abgaben entrichteten sie jährlich das Schutzgeld.
Die Bauern und Kossäten hüteten gemeinsam ihre Kühe, Schafe und Schweine in dem Eichwald, aber auch im nahen Kiefernwald durfte die Dorfschaft Rindvieh und Schafe hüten, dafür waren sie wiederum verpflichtet, im Walde Handdienst zu leisten und Holzfuhren zu fahren. Die Hütung auf der Feldmark gehörte zur Schäferei, also dem Gutsherrn. Ueber die Hütungsgerechtigkeit und den Walddienst werden wir bei den späteren Jahrhunderten genaueres hören. Der Lehnsherr gab ihnen zu Neubauten und Reparaturen das Bauhaus aus dem Walde, den Bedarf an Brennholz deckte das sogenannte Kabelholz, ein Dorfwald an der Westseite des Dorfes, dessen Größe später mit 160 Morgen angegeben wird.
Der Kirche waren bei der Verteilung 6 Morgen und der Pfarre 4 Hufen zugefallen, deren Nießbrauch frei von allen Abgaben der Pfarrer hatte.Dies entsprach dem Abscjluß des Zehntenstreites zwischen dem Markgrafen Otto und dem Bischof von Brandenburg 1238. Nach diesem Vertag stand dem Pfarrer von jeder Hufe der Feldmark ein Scheffel Roggen und ein Pfennig für Wachs zu. Die letztere Bestimmung ist unklar und scheint eine Entschädigung für die vom Pfarrer geleistete Beleuchtung der Kirche bei Frühmessen gewesen zu sein; statt des Pfennigs nennt das Visitationsprotokoll von 1540 „ein Schock Bundstroh“.
Wir können vermuten, daß der Locator und erste Lehnsschulze der Familie Duczek entstammte, welche freilich erst in einer Urkunde vom Jahre 1355 als Besitzer des Schulzenhofes genannt wird und inzwischen zu bedeutendem Wohlstand gelangt war.
Im Jahre 1289 erfolgte durch den Markgrafen eine genaue Nachprüfung der Hufenverteilung wie in allen Orten so auch in Pankow. Diese Nachvermessungen hatten oft eine besondere Bewandtnis. Sie wurden manchmal angeordnet, um für die leeren Kassen neue Einnahmen zu schaffen; denn jedes sich ergebende Mehr am Bestand des Dorfackers mußte die geschädigte Nachbarfeldmark ankaufen, und jedes Fehlende mußte neu gekauft werden, so daß manches Dorf sich vorher durch eine freiwillige Summe von der Vermessung loskaufte.
Mehr wissen wir über jene erst Kolonisation unseres Ortes nicht. Weder die Zahl der Bauernhöfe und Kossätenhöfe noch die Namen der Besitzer oder Pfarrer sind uns berichtet. Aber fest steht, daß hier niemals ein Rittergut, sondern nur ein Lehnschulzengut bestanden hat, dessen Lage wir noch heute Bestimmen können, was wir später sehen werden..
Unter der kraftvollen und weisen Regierung der Markgrafen aus dem Hause der Askanier bis 1324 folgte ein Jahrhundert des Aufblühens auch für unser Dorf, welcher die hauptsächlichsten Bedingungen zum Wohlstand, Wald, Wasser, Wiesen und fruchtbare Aecker, in sich vereinigte. Aber dann ging es wieder bergab, und 1370 erfolgte eine zweite Parzellierung der völlig verödeten Feldmark unseres Ortes. Wir fragen nach den Gründen des Verfalls.
Wie ein Gottesgericht war im Jahre 1348 ein furchtbarer Gast durch die Lande gezogen und hatte bei jedem Palast und jeder Hütte Einlaß gefordert. Es war die Pest, der schwarze Tod. Furchtbar wütete die Pest im Niederbarnimer Kreis. 15 Dörfer starben aus und sind verschwunden, es waren Ahrendsee, Berkau, Bernöwe, Alt- und Neu-Gröben, Brederwisch, Eggersdorf, Grabsdorf,Glienicke, Helwichsdorf, Schepforde, Liebenthal, Löhme, Triebusdorf, Woltersdorf bei Wiesenthal. Fast die ganze Bevölkerung auch unseres Dorfes sank in das Grab, einzelne Bewohner waren geflohen. Die Feldarbeit blieb ungetan, die Aecker verödeten, und die Bauern verpfändeten in der Not ihren Besitz, was sie in den wirtschaftlichen Untergang führte. Ein jahr hatte zerstört, was in Jahrzehnten mühsam errungen war.
Mit der Pest und ihren Folgen vereinigte sich manch andere Not. Nach dem Erlöschen des askanischen Hauses brach unter den Markgrafen aus dem bayrisch-Wittelsbacher Hause 1324–73 eine schwere Zeit der Verwirrungen, Kriege und Einfälle an. Eine Zerrüttung schlimmster Art riß überall ein, welcher kaiser Carl IV. nur vorübergehend steuern konnte. Außerdem erging über die Mark ein fürchterlicher Einfall der Polen und der noch heidnischen Litauer. In der allgemeinen Verwirrung erhoben sich die Städte zu einer gewalttätigen Unabhängigkeit, und die Ritterschaft raubte und plünderte in der Mark. Es ist undenkbar, daß unser Ort wie die meisten Dörfer in diesen Wirren und Nöten nicht schwer gelitten hat, daß Bauern und Kossäten nicht manche Plünderung erfuhren. „Von tag zu Tag,“ sagt eine alte Zeitgeschichte, „wachsen und mehren sich die Raubzüge und Fehden, die Dörfer liegen niedergebrannt, die Felder verwüstet, nackt und hilflos verlassen die menschen ihre Wohnungen, auf heimlichen Wegen müssen die Geistlichen ihrem Beruf nachgehen.“[1]
[1] Riedel: Mark Brandenburg
Folge 6
Was lag dem Markgrafen Otto dem Faulen (1351–1373), welcher der Einnahmen dringend bedurfte, an Dörfern, die ihm den Zehnt und den Zins nicht mehr zahlen konnten. Er verkaufte seine Rechte und Einnahmen an Pankow 1370 für das Zehnfache der Jahressolleinnahme, für 100 Mark Silber, nach unserem Gelde etwa für 2000 Mark an den Rat von Berlin und Kölln.[1] Die Verpfändungen ganzer Dörfer und Städte oder einzelner Hebungen, das sind Abgabeneinkünfte, durch den Landesherrn waren in jener Zeit nicht selten; sie waren einerseits in den durch Kriege oder andere Veranlassungen bedrängten Verhältnissen des Markgrafen begründet, andererseits darin, daß Darlehen nicht gegen Zinsen, sondern gegen Verpfändung bestimmter Einnahmen auf Wiederkauf gegeben wurden; das Pfandobjekt und dessen voller Ertrag ging bis zur Wiedergabe des Darlehns als Eigentum auf den Darlehnsgeber über. So gelangte der Rat dieser beiden Städte in den Besitz aller Einnahmen von Pankow an Zehnten, Ackerzins, Pächten und Gerichtsgeld. Die Bede wurde weiter an den Markgrafen entrichtet, ebenso blieb die Verpflichtung zum servitium curruum d. h. Spanndienst für den Krieg. Von besonderer Wichtigkeit ist die Frage, ob durch diesen Verkauf die Lehnsherrlichkeit des Markgrafen und das Patronat der Kirche beeinflußt wurde. Die Urkunde des Verkaufs ist nicht erhalten, aber da alle späteren Belehnungen in Pankow vom Markgrafen erfolgten, so ist erwiesen, daß der Markgraf Lehnsherr „dominus Foedi“ blieb. Eine Aenderung trat 1525, wie wir später sehen werden, ein. Bei jedem Uebergang eines Besitzes durch Vererbung oder Verkauf mußte bei der markgräflichen Kanzlei die Belehnung nachgesucht und dem Markgrafen die Lehnsabgabe hierbei nach wie vorentrichtet werden. War auch das Patronat der Kirche in den verkauf mit einbegriffen? Das ist die zweite wichtige Frage. Die frage nach dem Patronat wird überhaupt im weiteren Verlauf dieser geschichtlichen Aufzeichnungen in jedem Jahrhundert zu erörtern sein. Zweifellos war bis 1370 der markgraf Patron der Kirche zu Pankow. Die Markgrafen übernahmen überhaupt in der Mark der katholischen Kirche gegenüber eine besondere Stellung ein. Schon Markgraf Otto hatte 1238 im Zehntenstreit besondere Rechte errungen, und im Laufe des 14. Jahrhunderts erreichten die Markgrafen, daß die Bischöfe von Brandenburg und Havelberg ihnen als Vasallen unterstanden.[2] Wie zu diesen Rechten weitere kamen, werden wir bei der Einführung der Reformation sehen. Im Visitationsprotokoll von 1540 wird neben dem Rat von Spandau der rat von Berlin als Patron unserer Kirche genannt, und im Landbuch Carls IV. 1376 werden als Patrone die Gebrüder Duseke und der reiche Berliner Wartenberg, welchem der Rat von Berlin die Besitzung in Pankow verkauft hatte, als Patrone bezeichnet. Daher muß mit dem Verkauf 1370 auch das Patronat der Kirche zu Pankow vom Markgrafen auf die Räte von Berlin und Kölln übergegangen sein, welche es nach sehr kurzer Zeit den bedeutendsten Besitzern in Pankow, den genannten Duseke und Wartenberg, überließen.
Pankow blieb jedoch ein wiederkäufliches Lehen, so daß es den späteren Kurfürsten jeder Zeit freistand, ihre Rechte und Einkünfte wieder zu erwerben, was auch später geschah.
Die Räte von Berlin und Kölln ließen die verödete Feldmark unseres Ortes nicht ungenutzt liegen, sondern suchten für die wüsten, verlassenen Höfe neue Besitzer. Sie vollzogen eine neue Aufteilung der Aecker. Viele Höfe mochten 1370 herrenlos gewesen sein, aber nicht alle Höfe waren wüst. Ein Besitzer wird um 1355 genannt, Christian Duseke (Kerstian Duczek), den ich schon oben erwähnt habe. Er muß ein wohlhabender Mann gewesen sein, denn er borgte dem Landesherrn Geld und kaufte 1355 vom Markgrafen Ludwig dem Römer Hebungen in den Dörfern Wostermargk und Rewanth. Da wir die Nachfolger im Besitz seines Hofes bis in unsere Zeit hinein verfolgen können, und es auf den folgenden Blättern geschehen wird, so können wir noch heute den Hof genau bestimmen. Es war das alte Lehnschulzengut in Pankow. In jenem Lehnbrief[3] wird dieser Besitzer genannt „Christian Duseke zcu der Pangkow“. Die Pfandurkunde lautet:
„Wir Ludwig der Römer bekennen daz wir gelegen haben und lihen mit diesem briue den bescheiden luthen Kristianen Duseke zcu der Pangkow und Klawissen Renneboym Borger zcu Nauwen unsere lieben getruwen mit samender hant und ihren rechten erbenzcu eine rechten erblene zwe phunt beede Brandenborg phenninghe ierlicher pflege die da legen in deme Dorpphe zcu Wostrmargke zeen schillinge uf den einen krughe und zeen schillinge uf deme andern krughe, und een phunt derselben phennighe uf Heinen Brunniges Hofe in demselben Dorpphe. Und zwei phunt beede Brandenborg phennighe ierlicher gulde in deme Dorpphe zcu Rewanth zcu hebende und uf zcu nemende und zcu besitzende ewichlich ane alles hinder. Davor haben sie gegeben unserm lieben friederich von Lochen sechszeen mark brandenborg silbers, die her uns an unsern schulden sal abeslan an den schulden die wir im schuldigk sin.“
[1] Vermerk im alten köllnischen Copiario, S. 174. Die Urkunde ist nicht mehr erhalten. Berliner Rathausbibliothek
[2] Heidemann, „Die Reformation in der Mark“
[3] St. Rep. 78a 3.
Folge 7
Dem Landbuch Carls TV. verdanken wir die genaue Kenntnis der Verteilung der Feldmark unseres Ortes vom Jahre 1370. Dieses Landbuch ist eine der interessantesten und wertvollsten Geschichtsquellen. Die Veranlassung des Buches war die Verwirrung der Besitz- und Finanzverhältnisse in der Mark unter der unglücklichen Regierung der Wittelsbacher Markgrafen. Die Besitzrechte mußten wieder geordnet und festgelegt werden. Die im Jahre 1370 vom Rat zu Berlin und Kölln erfolgte Verteilung wurde in Pankow 1376 – wie im Landbuch bei dem Orte Schöneiche angegeben wird – vom Landreiter, dem markgräflichen Beamten, für das Landbuch aufgenommen. Das Landbuch berichtet nun über Pankow folgendes:
Panko sunt XLII mansi, quorum plebanus habet 4. Kerstian Duseke habet X ad curiam suam, VI liberos et IV censuales item II rustiales. Hans Duseken habet VII½ mansos ad curiam suam. Wardenberg civis in Berlin,habet XII½ mansos a consulibus in Berlin, qui habent proprietatem, quos colit per se. Ad pactum soluit, quilibet mansus VI modicossiliginis.IV ordei et VI auene, ad census quilibet II solidos, ad precariam VI solidos et VIII denarios, II½ quartale siliginis, II½ ordei et V quartalia auene. Cossati sunt XXII, quilibet soluit unum solidum etunum pullum, quorum cossatorum Wardenberghabet XIII ad manos suos. Duseken residuos.Tabernator dat VI solidos unum modium siliginis, I modium ordei et VI modius auene. Kerstian et Hans Duseken habent dimidietatem iudicii supremi et infimi et iuris patronatus, alteram dimidietatem habet Wardenberg supradictus. Servicium curruum habet marchio. Servicium vasallionatus est ibi.
Übersetzt:
Panko, da sind 42 Hufen, von denen der Weltgeistliche 4 hat. Kerstian Duseke hat 10 zu seinem Hof, 6 frei und 4 pflichtig, ebenso 2 Oedland. Hans Duseken hat 7½ zu seinem Hof. Wardenberg, Bürger in Berlin, hat 12½ Hufen von den Ratsherren in Berlin, welche das Eigentum haben, zu seiner Beackerung. An Pacht steuert jede Hufe 6 Scheffel Weizen, 4 Scheffel Gerste und 6 Scheffel Hafer, an Ackerzins jede Hufe 2 Schilling, an Bede 6 Schilling und 8 Denare, 2½ Viert Weizen, 2½ Gerste und 5 Viert Hafer. Kossäten sind 22, jeder steuert einen Schilling und ein Huhn. Wardenberg hat 13 Kossäten zu seinen Hufen, Duseken die übrigen. Der Krugwirt gibt 6 Schillinge, 1 Scheffel Weizen, 1 Scheffel Gerste und 6 Scheffel Hafer. Kerstian und Hans Duseken haben die Hälfte des Ober- und Untergerichts und des Patronatsrechts, die andere Hälfte hat Wardenberg. Den Wagendienst hat der Markgraf.Dort ist der Vasallendienst.
Daß die Abgaben, welche von den Hufen an den Pfarrer (plebanus, Weltgeistlicher im Gegensatz zu Klostergeistlicher) zu leisten waren, nicht erwähnt werden, läßt sich daraus erklären, daß das Landbuch nur die Regulierung der weltlichen Rechte im Auge hat, und daß andererseits die Abgaben an den Geistlichen durch den Zehntenstreit 1238 festgelegt waren.
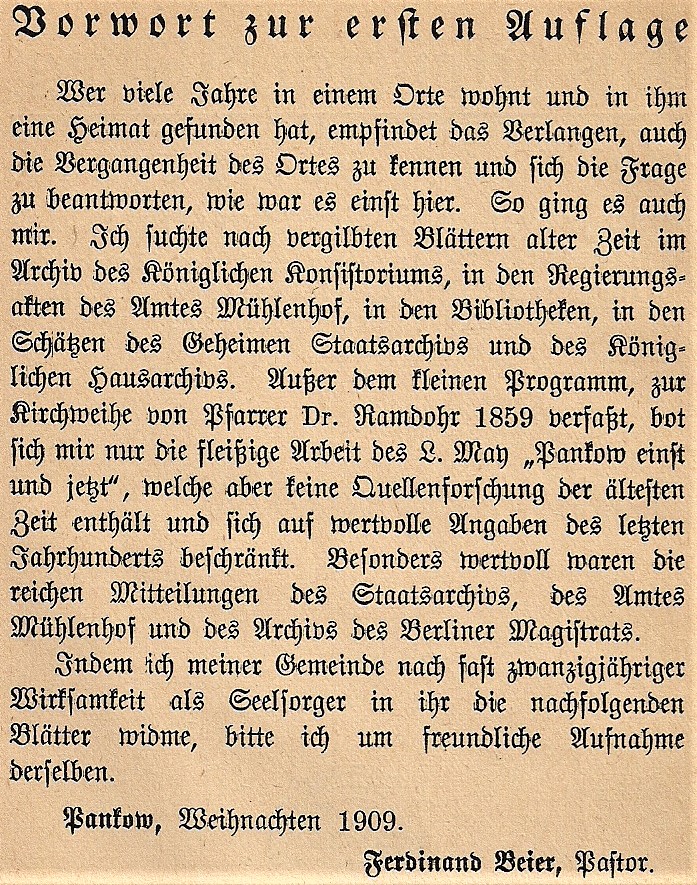
Merkwürdig ist, daß während 42 Hufen genannt sind, in der Verteilung nur 36 aufgezählt werden. Dr. Ramdohr schließt hieraus auf ein zinsfreies Rittergut. Ein Rittergut hat aber Pankow nie gehabt, die zinsfreien 6 Hufen sind auch bei dem Lehnschulzengut des Duseke genannt. Die 6 Hufen waren offenbar für 6 Bauernstellen reserviert. Bauern werden überhaupt nicht genannt, was sich leicht erklären läßt. In den wenigen Jahren seit der neuen Verteilung waren die vorhandenen Bauernhöfe noch nicht besetzt worden; die Bauernhöfe waren verfallen, erforderten zum Ankauf größere Barmittel und waren deshalb in jener drückenden Zeit schwerer zu verkaufen als die ackerlosen Kossätenhöfe, deren Kaufgeld oft recht niedrig war; noch 1680 wird im Kaufkontrakt des Generals Grumbkow der von einigen Kossäten restierende Kaufpreis ihres Hofes mit 44 Talern angegeben. Wir müssen staunen, wie hoch die Abgaben der Kossäten sind, welche dazu pflichtige Hofarbeiter des Duseke und Wartenberg sind; bedeutend sind ebenfalls die Zehntenabgaben und der Grundzins vo(… [fehlt im Druck])en Höfen.
Der Ortspfarrer wird ausdrücklich erwähnt, aber nicht der Küster, wohl weil dieser keinen Anteil am Acker hatte.
Folge 8
Als Patron der Kirche, welcher das ius patronatus und damit das Recht der Berufung hatte, ist das Brüderpaar Duseke und Wartenberg im Landbuch genannt, nachdem doch erst 1370 das Patronatsrecht auf den Magistrat von Berlin und Kölln übergegangen war und der Magistrat von Berlin noch 1540 als Collator (Patron) bezeichnet wird. Wir müssen annehmen, daß den Rat dieses Recht in Anbetracht des kleinen Dorfes wertlos erschien, daß aber den Besitzern Duseke und Wartenberg wie auch ihren Nachfolgern im Besitz viel daran lag, in dem Ort, wo sie große Besitzungen hatten und auf die Dienstleistungen der Dorfleute angewiesen waren, die Berufung eines ihnen genehmen Priesters selbst zu vollziehen. So mochte es gekommen sein, daß das ius patronatus von den Besitzern des Lehnschulzengutes ausgeübt und allmählich rechtmäßiger Besitz wurde. Leider waren die Lehnsbriefe für die Gebrüder Duseke nicht mehr zu finden. Alle späteren Besitzer des Schulzengutes werden mit dem „Kirchlehen“ ausdrücklich belehnt. Unter dem Kirchlehen ist stets das Patronat der Kirche, verbunden mit dem Recht, den Pfarrer zu berufen, gemeint.
So haben wir aus dem Jahre 1376 eine Uebersicht über unser Dorf. Jeder Hof war ein Lehen des Markgrafen. Die Abgaben, welche bisher dem Landesherrn entrichtet wurden, flossen dem Magistrat von Berlin und Kölln zu, mit Ausnahme der Bede und des Belehnungsgeldes für den Lehnherrn, den Markgrafen, und der Abgaben an den Pfarrer. Patron war Kerstian und Hans Dusekee sowie Wartenberg. Lehnsschulze war Kerstian Duseke. Kerstian Duseke besaß den Lehnsschulzenhof mit 6 freien und 4 abgabepflichtigen Hufen, Hans Duseke 7½ Hufen. Der reichste Besitzer war Tyle Wartenberg, welcher 1372 [1] „13 Hufen wüsten Landes für 45 Mark Silber, nach unserem Gelde etwa 900 Mark, vom Magistrat zu Berlin erworben hatte. Neben dem Lehnschulzengut westlich wohnte der Pfarrer, mit dessen Hof 4 Hufen verbunden waren. Auf beiden Seiten der Dorfstraße waren die Höfe der 22 Kossäten, von denen 13 dem Wartenberg und 9 dem Duseke zum Hofdienst verpflichtet waren. Dazu kamen noch einige unbesetzte Bauernstellen. Das Dorf umgab sicherlich zum Schutz eine Steinmauer. Es lehnte sich nördlich an das große Eichholz und westlich an die Heide, in welche das Vieh getrieben wurde. In der Mitte des Dorfes stand das kleine aus Granitsteinen erbaute Kirchlein, in dessen Schatten auf dem kleinen Friedhof die Toten ruhten.
Das Landbuch gibt uns auch über die Preise der Lebensmittel der damaligen Zeit Nachricht. Ein Scheffel Gerste kostete 10 Denare (Pfennig, 1 Denar hatte den heutigen Wert von 8 Pfennig; also 0,80 Mark).Ein Scheffel Hafer 5 Denare gleich 0,40 Mark. Ein Scheffel Weizen 16 Denare gleich 1,28 Mark; ein Scheffel Erbsen 20 Denare gleich 1,60 Mark. Ein Huhn 2 Denare gleich 0,16 Mark. Diese anscheinend sehr niedrigen Preise sind jedoch nicht zu gering zu schätzen, da das bare Geld damals höheren Wert hatte. Die Preise waren allerdings niedrig, weil der Absatz der Ware durch die schlechten Wege und jeden Mangel an Verkehrsmitteln sehr erschwert war. Die Städte hatten außerdem ihre eigenen Ackerbürger und bedurften wenig der Zufuhr vom Lande, so daß die Landleute ihre Produkte schwer veräußern konnten.
[1] Vermerk im alten köllnischen Copiario, S 174
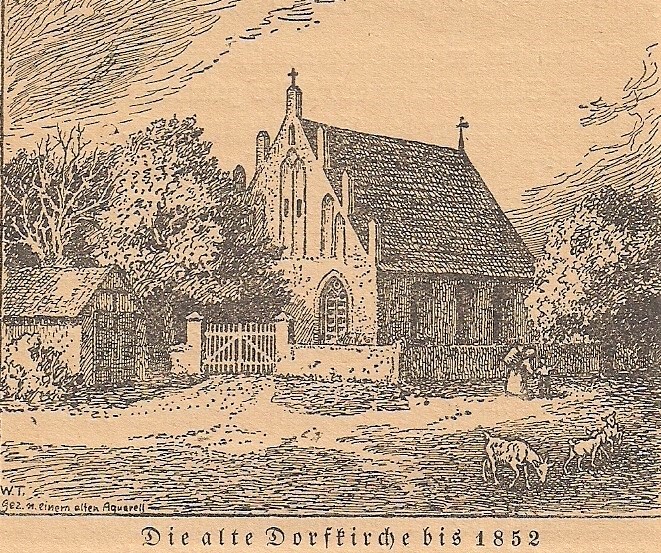
Bis zur Reformation
Es war für unsern Ort wertvoll, daß er 1370 in den Besitz der Städte Berlin und Kölln gekommen war. Dadurch genoß Pankow den Schutz dieser Städte. War die Mark unter der Regierung der bayrisch-wittelsbacher Markgrafen 1324-1373 tief gesunken, so verfiel sie unter den Lützelburger Markgrafen 1373-1411 noch mehr und wurde ein völlig wüstes Land. Schutzlos war sie den Einfällen der Nachbarn, Mecklenburg, Pommern, Sachsen und Magdeburg preisgegeben. Im Innern befehdeten sich die im Selbstschutz stark gewordenen Städte, und die Ritter unternahmen ungestraft ihre Raubzüge, denen die Dörfer zum Opfer fielen. Die Schilderungen der Not und Verwüstung aus jener Zeit sind erschütternd. Da war keine Macht, welche die räubernden und plündernden Fehdegesellschaften hinderte, die wehrlosen Dörfer ihres Viehs und ihrer Habe zu berauben, Wohnungen und Ställe in Brand zu stecken. Die Bewohner wurden oft erschlagen. Die ausgeplünderten Dörfer mußten sich obendrein zur späteren Lieferung von Getreide, Bier, auch „Bannergeld“ verpflichten, wenn sie ihre Behausungen vor den Flammen retten wollten. Die Gewöhnung an rohe Gewalttaten hatte die Menschen so tief entsittlicht, daß selbst Kirche und Kirchhof nicht gescheut wurden. Selbst die Kirchen wurden ausgeraubt, Kirchengeräte und Priestergewänder mitgenommen und die Scheunen, welche oft zum Schutz auf dem Kirchhof erbaut waren, geplündert. Mönche und Wallfahrer wurden selbst ihrer Kleidung beraubt. In dieser herrenlosen Zeit stand Pankow unter dem Schutz von Berlin und Kölln und mochte manchmal behütet worden sein, aber auch manche Plünderung wird es erlebt haben. Die Geschichte berichtet,[1] daß Dietrich von Quitzow, welcher in einem Prozeß gegen die Stadt Berlin unterlegen war, am 13. September 1410, ohne die Fehde angesagt zu haben, von Bützow, dem späteren Oranienburg, aus vor der Stadt Berlin mit seinen Spießgesellen erschien, Kühe und Schweine der Bürger von der Weide raubte und nach Schloß Bötzow brachte. Es ist wohl möglich, daß dieser Ueberfall auch Pankow traf, wo reiche Berliner ihren Sommersitz hatten und die Straße nach Bötzow vorüberführte.
Bessere Zeiten sollten anbrechen. 1412 kamen die Hohenzollern in die Mark. Burggraf Friedrich VI. von Nürnberg zog anfangs Juli 1412 in Berlin-Kölln ein; man öffnete ihm die Tore nur mit Widerwillen. Am 6. Juli bestätigte er die Rechte dieser Städte, also auch ihr Besitzrecht an Pankow. In harten Kämpfen brach er die Burgen der Raubritter. Im Bündnis mit dem Erzbischof Günther von Magdeburg (8. Dez. 1413) zerstörte er die Burgen zu Friesack, Golzow, Plaue und Beuthen. Aus seinem Testament geht hervor, daß er, von der Not gezwungen, selbst Kirchenglocken (z. B. aus der Marienkirche zu Berlin) zu Büchsen umgießen ließ. Die wirren Zustände in der Mark, von welcher man in der Welt sagte, „aus ihr komme niemand unberaubt hinaus, wenn er auch ganz Deutschland ungefährdet durchreist sei,“ schwanden unter Friedrichs kraftvoller Regierung allmählich, und die weit und breit in der Mark gefürchtete Macht des Burgadels nahm ein Ende. Das Land atmete wieder auf, und Niclaus Uppschlacht sang nach dem Fall der Ritterburgen über Friedrich:
Ach richer gott, dy furfte gut
Alle didt sy by von dy behut
Durch dyn vil hilge, dure blut;
Hy streit nach guden freden.
Darto syne edle fruwe zart,
Lat sy von dy nict sin geschart!
So sint sy beide wol bewahrt,
In dynen ewige rike.
Noch einmal ritt Friedrich zum Kaiserhof und kam nach vierzehn Monaten im Oktober 1415 als Kurfürst und vollberechtigter Erbherr der Mark wieder, dieses Mal feierlich mit offenen Armen empfangen. Am 2. Oktober huldigte ihm Berlin. Er war ein frommer Mann und nannte sich gern „Gottes Amtmann am Fürstentum“.
Unter denen, welche ihm bei seinem ersten Einzug gehuldigt hatten, war auch der Lehnschulze von Pankow. Am 23. August 1412 kniete er huldigend vor seinem neuen Landesherrn und wurde von neuem mit seinem Hof-Schulzenamt und Patronat belehnt. In der Urkunde heißt es:
„Ebel Ducek recepit in den dorff czu Pankow czwelff stuck guldes und einen freyen hoff mit Aht huben und das halbe dienste, das halb kirchlehen, das halbe Oberste usw.“[2]
Es folgten Jahre des Friedens und des Aufblühens für die Mark und unseren Ort. Nur einmal noch in diesem Jahrhundert kam Ueberfall und Verwüstung über Pankow, als 1432 die Hussiten verwüstend und raubend durch die Mark zogen und bei Bernau vernichtet wurden. Aber diese Not war doch nur von kurzer Dauer.
Wie es in der Pankower Chronik weitergeht, lesen Sie bitte in der nächsten Folge.
[1] Hafftitz bei dem Jahre 1410. G. W. von Raumers Codes I 84.
[2] R. C. I 51
Folge 9
Gern weilten die Hohenzollern in Pankow, was dafür spricht, daß Pankow in seiner Umgebung damals sehr anziehend gewesen sein muß. Johann Cicero (1486–99) besaß am Rande des Eichwaldes unmittelbar an der Panke einen Vogelherd. Die letzten Reste desselben sind erst 1908 bei dem Bau des Krankenhauses verschwunden, an dessen Westgrenze er lag. Es war eine künstlich geschaffene, durch einen Wassergraben von der Panke her umgebene Insel. Von Interesse ist, was hierüber in der Microcronicum Marchicum des Rektors zu Berlin, Peter Hafft (Petrus Hafftitius) 1594 berichtet wird: [1]
Anno Christi 1486 den 11 Martii ist zu Frankfurt am Main Markgraf Albrecht, der deutsche Achilles, Churfürst zu Brandenburg seines alters 72 Jahr gestorben und ist an seiner statt Churfürst worden sein Sohn Markgraf Johannes welcher von Churfürsten dieses Stammes in der Mark zum ersten Hoff gehalten hat und weil er große Lust zum Weidewerk gehabt, hat er beim Dorffe Panckow, eine halbe Meile von Berlin gelegen, seine Vogelhert gehabt, auch ein schönes Haus in Holzwerck mit zwei Erckern und einem breiten Wassergraben daselbst machen lassen, auch halbe Merkische Gröschlein müntzen lassen, welche man die Pankowischen groschlein genannt hat und für wenige Jahren noch sind ganggebe gewesen, sind aber wegen ihres guten Schrodts und Korns von Granulierern aus dem Mittel getan, daß man selten eins zu sichte bekumt. Das haus ist hernach verschenkt, abgebrochen und steht heutigestags noch zu Berlin hinter Nickel Köckeritzes haus an der Sprewe (al: Dr. Bartels hawß in der heil geiststraßen) und der Wall darauf das Haus gestanden mit dem Wassergraben ist noch zu Panckow zu sehen.“
Eine diesem Vogelherd ähnliche Nachahmung, eine Insel mit Graben, befand sich anfangs des 19. Jahrhunderts auf dem Brunzlowschen Grundstück, dem alten Garten des Lehnschulzenhofes, an der Breiten und Berliner Straße; diese Nachahmung wurde fälschlich für den historischen Vogelherd gehalten. Der Vogelherd lag nicht i m Dorf, sondern b e i dem Dorf. Die Anlage eines Vogelherdes auf dem Schulzenhof war auch sehr unwahrscheinlich, dagegen an der fließenden Panke und am Waldesrand friedlich und still gelegen. In einer Vernehmung 1725 (Amt Mühlenhof, Dom. 47, Nr. 3) wird die Lage des Finkenherdes ebenso angegeben: Das kleine Inselchen liegt im Feld.“Auch die Separationskarte von 1822 zeichnet sie an dieser Stelle. In diesem Erkerhaus hat Johann Cicero viel und gern geweilt, auch manche Regierungsgeschäfte erledigt. Er unterzeichnete in Pankow 1495 eine Urkunde für die Gräfin Anna von Ruppin,[2] 27.3.95 eine Urkunde an Georg von Stein,[3] 7.4.96 eine Urkunde,[4] Verleihung eines Burglehens zu Tangermünde 4.10.97;[5] an demselben Tag eine Schuldverschreibung,[6] 15.9.96 einen Antrag an seine Räte[7] und andere Akten 1497 und 1498.
Daß Johann Cicero hier eine Münzstätte gehabt haben soll, ist trotz der Angabe des Peter Hafft unwahrscheinlich. Das flache Land war für eine Münzstätte zu unsicher. Eine Chronik des Pfarrers Ideler aus dem Jahre 1712, welche im Original freilich nicht mehr existiert, aber im Auszug in den Aufzeichnungen des Geheimrates Beckmann[8] enthalten ist, hegt ebenfalls Zweifel. Diese Chronik sagt: „Man will sonst auch von Pankowgroschen sagen, ist aber ungewiß, wie weit der Sage zu trauen. Soviel ist jedoch gewiß, daß ein stahlerner Stempel mit Brandenburgwappen in der Erde allda gefunden.“ Wir wissen aber, daß die Prägung gewöhnlich einem privaten Münzmeister, und zwar in der Stadt Angermünde übertragen wurde. Die Münzen jener Zeit tragen alle nur das Wappen, aber keinen Ortsnamen. Es ist möglich, daß man damals von Pankowgroschen sprach aus einer uns nicht bekannten Veranlassung. Da wir nur auf die Nachricht des Peter Hafft angewiesen sind, die Geschichte sonst aber von Pankowgroschen nichts berichtet, die Angaben des Peter Hafft im übrigen auch nicht immer glaubhaft sind, so ist eine Entscheidung mit Sicherheit nicht zu treffen.
Wie sich in unserer Zeit der Zug der reicheren Berliner Familien nach den westlichen Vororten wendet, so war in früherer Zeit die Liebe der Berliner auf Pankow und Nieder=Schönhausen gerichtet. In unserem Orte schufen sich die Patrizierfamilien Berlins herrliche Sommersitze. Wir sahen, daß Tyle Wartenberg 1372 hier bedeutenden Besitz erworben hatte, und daß selbst die Markgrafen hier Erholung und Ruhe suchten. Meynke Crusemark, ein Bürger Berlins, wurde am 26. Juli 1438 mit zwei Bauernhöfen, den zugehörigen Hufen, zwei weiteren Hufen und einem Kossätenhof belehnt.[9]
Frederich der Junge bekennen, daß wir unserem lieben getruwen Meynicke Crusemarcke zcu panckow zcwu hufen czween hufener hove und einen Kossetenhoff und daselbst in der mule sechs scheffel roggen mit allen frihiten in allermassen dieselben gute Cune Crusemargk, sein Vater seliger, vormals von der marggraweschaft innegehabt und auf ihn geerbt hat, gelihen haben. Wenn es auch sieh, das der genannt meyne Crusemarck ane menlich liebeslebenserben abginge oder sin Sone desgleichen, so haben wir katherinen, margarethen und Annen, geschwestern, des genannten meinigke Crusemargken tochtern, die besundere gnade getan, das sie sullich gute alle ire lebetage zum lipgedinge Inne haben.“
Das läßt andererseits aber auch auf die damals traurige Lage der Bauern schließen, denn diese Höfe waren sicherlich verfallen und von ihren Besitzern einst in der Notlage aufgegeben worden. Auch der Lehnsschulzenhof wechselte seinen Besitzer. Wir erfahren, daß 1453 die Familie Duseke ihren vielleicht schon Jahrhunderte hindurch besessenen Hof an die Familie des Berliner Bürgermeisters Blankenfelde veräußerte. Die Veranlassung des Verkaufs kennen wir nicht. Es ist möglich, daß beim Todesfall des Besitzers ein männlicher Erbe nicht lebte, und daher das Gut, welches ein Mannlehen war, in eine andere Familie übergehen mußte. Da die Familie Duseke aber, wie wir oben sahen, auch in anderen Dörfern Belehnungen besaß, so kann es sich auch im Interesse dieser Besitzungen um einen freiwilligen Verkauf gehandelt haben. Zwei Urkunden betreffen diesen Besitzwechsel. Nach der einen bestätigt der Kurfürst am 24. Dez. 1453 den den Bürgern Wilke und Hans Blankenfelde zu Berlin erteilten Lehnsbrief über das halbe Dorf Pankow, in der Urkunde heißt es:
„Der Kurfürst belehnt Wilke und Hans Gebrüder Blankenfelde mit dem Dorfe Seefeld …… sowie mit dem halben Dorf Pankow, dem dazu gehörigen halben obersten und niederen Gericht, freier Schäferei, dem halben Kirchenlehen, obersten und niederen Gericht über ihre Leute, Zinsen, Gebüschen, Weiden etc., wie diese Güter Ebel Duseke und früher Fotzenbart besessen hat. Datum Cölln am Freitag nach dem heiligen Pfingsttage 1455.“[10]
Durch diesen Besitzwechsel wurde der Lehnsschulzenhof ein herrschaftliches Gut. Der Hof und das Kirchenpatronat ist nicht wieder in den Besitz einer bäuerlichen Familie übergegangen. Magistrat, Männer der Wissenschaft, des hohen Beamtentums, ja selbst die Kurfürsten und Preußens Könige haben ihn nacheinander, bis er parzelliert wurde, besessen. Der Hof wird später „bonum“ (Gut) genannt.
Dadurch war aber auch das Patronat der Kirche, wie der Lehnsbrief ausdrücklich besagt, auf die Familie Blankenfelde übergegangen, aber nur die Hälfte des Patronats. Wer mag den anderen Teil des Patronatsrechts besessen haben?
Nach dem Landbuch Carls IV. (1376) war Wartenberg mit der zweiten Hälfte desselben belehnt worden. Von diesem Lehnsitz ist nun nirgend mehr die Rede. Wenn auch später ein Bauer Wartenberg wieder genannt wird, so haftet doch an dessen Hof kein besonderes Recht, so daß wir annehmen müssen, daß die spätere Bauernfamilie Wartenberg mit jenem Besitzer gleichen Namens vom Jahre 1376 keinen Zusammenhang hat. Achten wir jedoch darauf, daß im Landbuch ausdrücklich von den 12½ Hufen des Wartenberg gesagt wird, daß deren Besitz dem Magistrat von Berlin zustand „qui habent proprietatem“ und daß Wartenberg sie gleichsam nur auf Zeitpacht hatte, so liegt der Schluß nahe, daß Wartenberg oder seine Familie den Besitz der Hufen wieder an den Rat von Berlin zurückgegeben hatte. Das würde auch erklären, daß 1540 der Rat von Berlin als Mitpatron genannt wird. Die Hufen des Wartenberg wurden wahrscheinlich vom Rat zu Berlin einzelnen Kossätenhöfen zugelegt und diese zu Bauernhöfen dadurch gemacht. So läßt es sich auch erklären, daß in der Folgezeitin Pankow sich 14 bis 16 Bauernhöfe befinden, während das Landbuch Carls IV., wie wir sahen, Bauernhöfe im Ort noch nicht kennt. Nach dem angeführten Lehnsbrief war mit dem Gut auch die freie Schäferei, welche getrennt vom Gutshof lag, verbunden.
[1] R. C. I V 1 Seite 75.
[2] R. C., A. 9, 248.
[3] R. C., C. 9, 403.
[4] R. C., A. 10, 167.
[5] R. C., A. 16, 120.
[6] R. C., A. 19, 56.
[7] R. C., C. 2, 415.
[8] St.
[9] L. XVII 36. R. C. A. 11, S. 343.
[10] R. C., Suppl. I 305.
Folge 10
Zwei Urkunden dieses Jahrhunderts geben uns über die pfarramtlichen Verhältnisse unseres Ortes in der alten Zeit Aufschluß. Pankow war ein Pfarrort (mater, Mutterkirche); zu ihm gehörte schon damals die Kirchengemeinde Nieder=Schönhausen als Tochtergemeinde (filia). Aber auch der Wedding war in Pankow eingepfarrt. Darauf bezieht sich eine Urkunde, welche lautet:
„Dit is die ewige Rente up deme Rathuse tu Berlin: Perrer tu Pankow 1 chorum Roggen.“
Statt dieses Scheffels Roggen bezog der Pfarrer später nach dem Visitationsprotokoll von 1540 für die seelsorgerliche Versorgung des Weddings 24 Groschen vom Rat zu Berlin. Wann der Pfarrer von Pankow mit der Seelsorge auf dem Wedding betraut worden ist, läßt sich nicht bestimmen, vielleicht schon 1289, denn in diesem Jahre am 14. August hatte der Markgraf Otto den Hof Wedding den Bürgern „zu einem rechten und ewigen Lehen mit allen Rechten und mit aller Macht, welche er selbst daran besessen“ geschenkt.[1] Der Weg zum Wedding war weit und sandig und die Besoldung mit einem Scheffel oder 24 Groschen jährlich gewiß merkwürdig gering. Der Pfarrer zu Pankow mit dem Filial Nieder=Schönhausen und dem Wedding unterstand in alter Zeit bis zur Reformation der Probstei Bernow (Bernau), welche ein Teil des Bistums Brandenburg war.[2] Auf einen besonderen Festtag in kirchlichen Leben läßt uns die Jahreszahl der ältesten Glocke unserer Kirche (1475) schließen; Blankenfelde, der neue Patron der Kirche, mag die Glocke der Gemeinde zum Geschenk gemacht haben.
Ehe wir in das Jahrhundert der Reformation hineingehen, möge eine für jene Zeit bedeutsame Frage beantwortet werden. Hatte das Kloster zu Spandau auch in Pankow Besitz? Die Vermutung liegt wohl nahe, weil dieses Kloster, einst nach einer Urkunde 1239 von den Markgrafen „Johannsen und Otten“ gegründet und reich ausgestattet, in vielen Dörfern der Mark große Besitzungen hatte; zum Beispiel in Schöneberg seit 1264 fünf Hufen, in Seegefeld seit 1265 vier Hufen, die Kirche zu Rohkow seit 1270, in Staaken seit 1273 acht Hufen, in Mahlow seit 1287 zwei Hufen, in Beyersdorf seit 1317 neun Hufen, in Berlin und Kölln seit 1318 den Fischzoll, in Küstrin Hebung von „Hähringen“ und in Potsdam Hebung von Garn. Das Kloster besaß die Jungfernheide, welche nach dem Kloster den Namen führt und fast bis an Pankow heranreichte; es besaß zweiundzwanzig Hufen in Nieder=Schönhausen und seit 1251 als Geschenk der Markgrafen Johann und Otto eine dem Friedrich von Kare abgekaufte Mühle an der Panke beim Dorfe Wedding, welche nicht mit der Pankemühle in unserem Dorf zu verwechseln ist. Aber nirgends findet sich ein Hinweis auf einen Besitz in Pankow. Wir können die Frage demnach verneinen. Die Erklärung liegt darin, daß unser Ort dem Rat von Berlin und Kölln gehörte. Die Städter sahen ungern, daß die Rechte der Klöster immer größer und größer wurden, und die Bauern und Kossäten waren zu arm, um Schenkungen machen zu können.
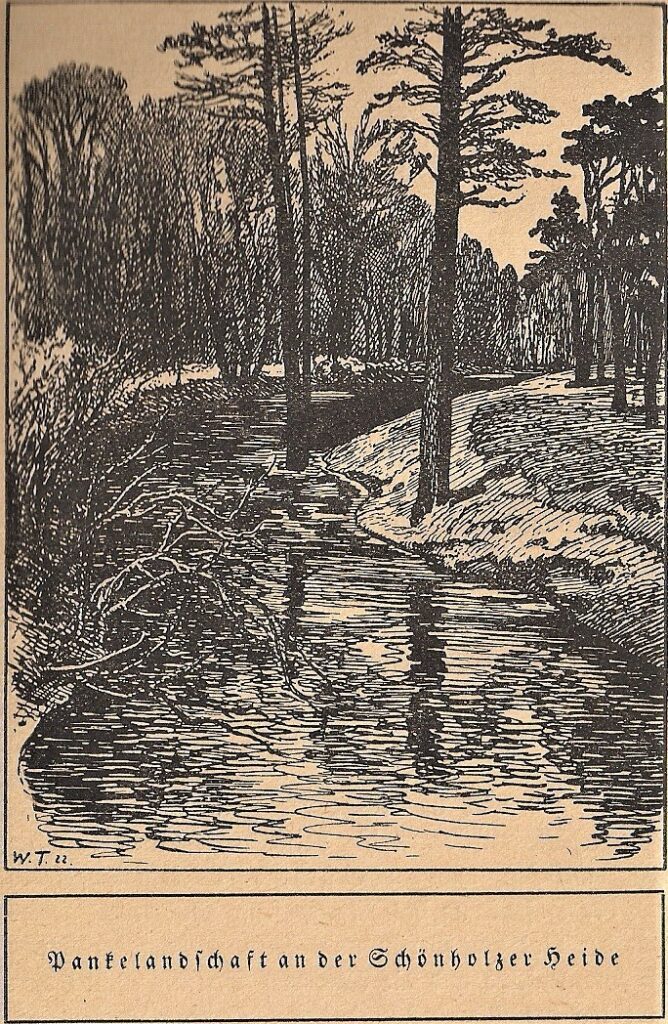
Ueberschauen wir unseren Ort am Ende dieses Jahrhunderts. Er hatte einige schön gepflegte Besitzungen, nämlich das Gut im Besitze der Familie Blankenfelde, einige Höfe, auf denen die vornehme Berliner Familie Krusemark saß, und das Erkerhaus mit dem Vogelherd und der Hofhaltung des Markgrafen. Besitzer des Ortes war der Rat von Berlin und Kölln, Patron der Kirche die Blankenfelde und die Räte von Berlin. Neben dem Gut lag der Pfarrhof, und den bleibenden Dorfteil bewohnten einige arme Hüfner und eine Anzahl noch ärmerer Kossäten. Reichtum und Armut, Glanz und Elend, Herrschaft und völlige Machtlosigkeit wohnten dicht nebeneinander. Die Bauern und Kossäten fristeten, jedes Rechtes ledig, ihr mühseliges Lebenvom Ertrag der geringen Höfe, hartgedrückt durch hohe Abgaben, Tagelöhner der reichen Berliner im Ort. Mancher Hof lag wüst, die Häuser waren mehr oder weniger verfallen.
Folge 11
Das Jahrhundert der Reformation
Die Zeit der Reformation brach an. Welche die Gemüter überall tief erregte. Ein Frühlingsrauschen ging durch die Welt, welche religiös und sittlich erstorben war. Die Visitatoren, von denen wir später hören werden, waren erschrocken über den Mangel an religiösem Wissen nicht bloß des ganzen Volkes, sondern auch der Geistlichen. „Der gemeine Haufe wisse weder von Gott noch von seinem Wort noch von den Sakramenten“, klagten sie.[1] Dem Klerus fehlte es nicht allein an dem notwendigen Bildungsgrad, sondern auch an Selbstgefühl und Selbstbeherrschung. Wenn auch gegen die Sittenverderbnis der Priester die märkischen Bischöfe von Brandenburg und Havelberg mit Edikten vorgingen, so konnte das Uebel doch nicht mehr beseitigt werden. Völlerei und Sittenlosigkeit, Mißbrauch der Amtsgewalt und Vernachlässigung der Pflichten zogen der Geistlichkeit die Mißachtung des Volkes zu. Dazu kam, daß das Los der Dorfgeistlichen nicht glänzend war. Auf ihnen lagen drückend große Abgaben an den Bischof. Sie entrichteten das Cathedraticum, gewöhnlich der zehnte Teil ihres Einkommens, das Synodaticum, zur Bestreitung der durch Abhaltung der Synoden entstehenden Kosten, die Prokurationsgelder zur Verpflegung des inspizierenden Bischofs, ferner ganz willkürlich bemessene gelegentliche Geldforderungen für den Pabst, welche der Bischof unter dem Namen Liebesgabe „subsidiumcuritativum“ einsammelte und nach Rom sandte. So zahlte der Klerus des Bistums Brandenburg im Jahre 1370 an den Pabst 780 Goldgulden.[2] Den Geistlichen blieb kein anderes Mittel, als diese Abgaben ihren Beichtkindern abzufordern. Was Herren und Priester dem Volke nicht nahmen, das trug es zu den Wunderstätten, denen man oft den letzten Pfennig opferte. Und wie zahlreich waren diese Wunderstätten in der Mark, zu Stepenitz, Zehdenick, Belitz, Techow, Nauen, Wilsnack.
Der letzte katholische Pfarrer in Pankow hieß Krüger. Offenbar hat er bei der Einführung der Reformation 1539 unseren Ort verlassen, denn es ist schwerlich anzunehmen, daß sein Tod mit jenem Tag zusammenfiel. Die meisten Prister verließen damals ihre Pfründe, denn sie waren den hohen Anforderungen, welche die Regierung an die Geistlichen der evangelischen Kirche stellte, nicht gewachsen. Der Pfarrer sollte der geistige Führer seiner Gemeinde in weltlichen wie religiösen Dingen sein, darum forderte man von ihm ein akademisches Studium und die Ablegung einer Prüfung. An die stelle des lateinischen Meßkanons trat die Predigt in deutscher Sprache und die religiöse Belehrung des Volkes. Johann Moller war nach dem Visitationsprotokoll von 1540 der erste evangelische Pfarrer von Pankow und Nieder=Schönhausen. Zum erstenmal nahm die Gemeinde das Abendmahl in beiderlei Gestalt und sammelte sich um Gottes Wort.
Nachdem die Gemeinden den Uebertritt zur Lehre der Reformation vollzogen hatten, war es die dringende Aufgabe der Regierung, das märkische Kirchenwesen zu gestalten, die Formen des Gottesdienstes zu betimmen und das Kirchenvermögen festzustellen. Letzteres war besonders nötig, denn es war zu befürchten, daß in der Zeit des Ueberganges die Besitzungen und Rechte der Kirche, Pfarren und Küstereien verlorengehen konnten. Verpflichtete weigerten sich auch tatsächlich, ihren Pflichten nachzukommen. Geistliche flüchteten zahlreich, wie aus den von Johann Weinlöben 1540 verfaßten „Artikeln belangende der Kirchen und geistlichen Güter“ [3] hervorgeht, unter Mitnahme der Kelche, Monstranzen, des baren Geldes und der Schuldbriefe; Patrone zogen eigenmächtig Kirchengüter ein. Die Landstände nahmen 1540 die „märkische Kirchenordnung“ an, und noch in demselben Jahre begann der erste Generalsuperintendent der Mark Jakob Stratner, der Rechtsgelehrte Johann Weinlöben und ein Kommissar des Bischofs zu Brandenburg die Kirchenvisitation, welche 2 Jahre dauerte. Das Visitationsprotokoll Barnimscher Dörfer in der Umgebung Berlins enthält auch die Aufzeichnung der Visitation zu Pankow: [4]
„Pankow, ist itzo Pfarrer Er. Johann Moller, Collatores (Patrone) die rehte zu Berlin und Spando, hat 1 Kelch, 1 monstrantzen, 1 pacem, hat LXXX Communikanten, tregt das Opfer des Jar bei XL gr (Groschen), hat ein Pfarrhaus, dotzu gehorn IIII hufen. Wan die ausgethan, tragen sie II W (Wispel) halb rocken halb hafern, hat III Wiesen, hat kabelholtz, XXIIII gr vom Wedding, gibt der Rath zu Berlin, hat XXXVIII hufen vor diesem Dorffe, hat die Pfarr von jeder Hufen ein Scheffel, 1 Schock pundstroh vor des Wachs. Kuster hat ein Kusterhaus, XXXII scheffel jelich scheffelkorn eitel roggen, II brot aush jedem hause, II Eier von einer hufen, II gr gotshaus, II gr 1 mahlzeit der pharrer.
Gotshaus hat sechs morgen lands, VI schock hauptsumma hat peter koldaw, burger aus Berlin, aus diesem gotshaus bekommen, sol jerlich 24 gr Zins geben, ist ins ratsbuch vorschrieben (eingetragen), II Schock hauptsumma Andreas schreck zu Berlin, ists 4 Jahr schuldigt gewesen, gibt kein Zins, ist nicht vorschrieben, II Schockthewes Dene zu Pankow, gibt nicht Zins; hat noch bish in VI schock bargeld in der kirchen liegen. Diese Pfarr hat ein filial zu Schönhausen.“
Das Visitationsprotokoll ist ein wertvolles Seitenstück zum Landbuch Carls IV. Dort die Aufzeichnung des weltlichen Besitzes und hier die Ergänzung, die Mitteilungen über die kirchlichen Güter. Das Protokoll ist in großen Zügen verfaßt, knapp und kurz, wie es durch die Kürze der Zeit und den enormen Umfang der zu bewältigenden Arbeit wohl geboten war. Ueber die Stolgebühren und manche kleine Einnahmen ist man hinweggegangen; um diese war das Kirchenregiment wohl auch nicht besorgt, da dieselben jederzeit festgestellt werden konnten und ein Verlust der Kirche nicht zu befürchten war. Aufzeichnungen hierüber begegnen wir in späterer Zeit. Die aufgeführten Abgaben an den Pfarrer und Küster sind nicht neu bestimmt, sondern entsprechen der früheren Zeit. Zum erstenmal wird (korr.: werden) hier im Protokoll der Küster und das Küstergehöft erwähnt. Sicherlich hat nicht die Reformation erst beides geschaffen, dazu waren die Bauerngemeinden damals viel zu arm; dieses Amt und Haus hatte seine Begründung gewiß gleichzeitig mit der Einrichtung des Pfarramtes im Ort. Merkwürdig ist der verhältnismäßig große Barbesitz der Kirche, welcher 16 Schock Groschen beträgt. Dieses Vermögen ist wohl durch die Pachtverträge der 6 Morgen Kirchenacker, welche eine Dotation aus der Entstehungszeit der Kirche waren, und aus Opfern und Liebesgaben bestanden. Der Pfarrer Moller bezog nach diesem Protokoll aus Pankow das Abendmahlsopfer mit etwa 40 Groschen, den Ertrag von 4 Hufen Pfarrland, von 38 Hufen Gemeindeland – also auch von den 4 freien Gutshufen – zusammen 38 Scheffel Getreide und 38 Schock Bundstroh und vom Magistrat zu Berlin 24 Groschen für die Seelsorge auf dem Wedding. Der Küster hat Anrecht auf 32 Scheffel Getreide entsprechend den Gemeindehufen, mit Ausnahme der 6 freien Gutshufen, auch 2 Brote aus jedem Haus und 2 Eier von jeder Hufe; außerdem 2 Groschen jährlich aus der Kirchenkasse und zwei Groschen und eine Mittagsmahlzeit vom Pfarrer. Land hatte die Küsterei nicht.
[1] Heidemann, Reformation.
[2] R. C. I 8, 295
[3] R. C. III 3, 471
[4] R. C. A. 11, 477
Folge 12
Das war ein schmales Einkommen für Pfarrer und Küster, welches sich allerdings um die Hufenabgaben des kleineren Filials Schönhausen und um die freilich geringen Gebühren bei den seltenen Amtshandlungen vermehrte. Wir werden später hierauf zurückkommen. Dem Pfarrer wurde es obendrein oft schwer, die ihm zustehenden Einnahmen zu erhalten: das geht aus dem Visitationsprotokoll[1] von Schönhausen hervor, in dem es heißt: „Auch hat der Pfarrer zu Pankow geclagt, das ime Christoffel barfuß (Patron und Besitzer des Rittergutes Schönhausen) den halben Wiesenwachs abgezogen und gebeten im dene wider zuzueignen.“ Es ging ihm wie der Kirche, welche nach dem Protokoll mit ihrer Zinseinziehung ebenfalls schlechte Erfahrungen machte.
Ein zweites Visitationsprotokoll haben wir aus dem Jahre 1574,[2] aus der Amtszeit des Pfarrers Zimmermann, welches bei sonst wörtlicher Uebereinstimmung in einigen Mitteilungen von dem Protokoll aus dem Jahre 1540 abweicht. Es nennt unter den Besitzteilen die Monstranz aus Kupfer, für die Pfarre einen Garten, für diKirche eine Wiese, welche Simon Stromann für jährlich 2 Groschen gepachtet hat, und den Bierzeitenpfennig. Dagegen fehlt jede Erwähnung eines Barvermögens der Kirche. Es schließt mit einer eigenartigen Anordnung des Visitators: „Es sollen hinfuro die Bauern zu Pankow nichts mehr denn 2 Tunnen Bier bei Pflügung der 6 Morhen Landes und Abbringung des Korns zu fordern haben und eine Tunne zum Dreschen, aber das Bier auf dem Palmtag soll gar abgethan sein und so die Gotteshausleute darüber solches ausgeben wurden, sollen sie es der Vorstand.“ Bei der Beackerung der 6 Morgen Kirchenland, welche die Bauern ohne Lohn zu verrichten hatten, wurde die Verpflegung der Arbeitenden an Getränken aus der Kirchenkasse bezahlt. Offenbar wurde die Grenze des Erlaubten manchmal überschritten und daher die Anordnung getroffen, daß in diesem Fall die Kirchenvorsteher, welche zwei Bauern waren, die Mehrunkosten tragen sollten. Der besondere Trunk am Palmsonntag wird ganz abgestellt. Das muß ein merkwürdiger, mittelalterlicher Brauch gewesen sein, daß den Bauern am Palmsonntag. An der Schwelle der Karwoche, von der Kirche „eine Tunne Bier“ gegeben wurde.
Derselbe Grund, welcher 1540 die Visitation veranlaßte, bestimmte wohl die Regierung, auch die wertvollen Monstranzen, welche im evangelischen Gottesdienst keine Verwendung mehr fanden, einzuziehen.
Am 8. August 1540 übergaben die Visitatoren den Silberbeamten des Kurfürsten die Monstranz unserer Kirche, die Urkunde lautet:[3]
„Zu wissen, das die verordneten Visitatoren des Churfürstenthumbs der Mark zu Brandenburgk Mittwoch nach Assumptionis Marie des XL. Jars (18. August 1540)unsres gnedigsten herrn des Churfürsten zu Brandenburgk Sylberknechten volgendt kirchensilber Stückweißüberantwortet und zugewogen. Eyn Monstrantz von Bankow wigt Sybnthalb Mark, Syben lott.“
Eine zweite wertlosere Monstranz aus Kupfer hat die Kirche behalten, welche als Altarkreuz weiter in der Kirche Verwendung fand, wie ein Visitationsprotokoll von 1574 und Pfarrer Ideler 1716 in seiner Designation angibt. Die Kurfürsten mußten zu dem Einziehen der wertvollen Monstranzen als Lehnsherren doch wohl berechtigt gewesen sein, freilich haben sie, durch Rechtserkenntnis gezwungen, dieselben manchmal zurückgegeben, so z. B. der Klosterkirche zu Berlin. Wie wir schon früher sahen, nahmen sie der Kirche in der Mark gegenüber eine besondere Stellung ein. Friedrich II. erwarb 1447 das Recht, die Bistümer Brandenburg und Havelberg mit ihm genehmen Persönlichkeiten zu besetzen, und Joachim I. fügte diesem Recht 1514 das Patronatsrecht über die Domkapitel dieser Bistümer und das Recht, den Domprobst zu ernennen hinzu. Die Hohenzollern hatten so die bischöfliche und die geistliche Gewalt in der Mark völlig in ein Abhängigkeitsverhältnis von der weltlichen Herrschaft gebracht.[4]
Die Reformation fand im Augsburger Religionsfrieden auf dem Reichstage zu Augsburg am 25. September 1555 ihren Abschluß. „Niemand dürfe wegen des Ausburgischen Bekenntnisses angegriffen werden,“ so bestimmte die Versammlung der Stände und Frürsten. Der Sieg des Lutherischen Glaubens wurde im kommenden Jahr in den lutherischen Landen gefeiert. Unsere zweite alte Kirchenglocke, welche die Jahreszahl 1556 trägt, läutete bei dem Sieges- und Friedensfest unserer Gemeinde zum erstenmal; sie ist ein Dankopfer der Gemeinde gewesen und sollte für alle Zeiten ein Denkmal der Reformation bleiben.
Die kirchliche Verbindung unserer Gemeinde mit Bernauwurde durch die Reformation gelöst und Pankow, wie alle nahen Dörfer um Berlin, der Stadtsuperintendentur Berlin unterstellt, welche vom Pfarrer der Nikolaikirche ausgeübt wurde. Pankow gehört seit dieser Zeit kirchlich zu Berlin. Darum führt noch heute unsere Superintendentur in ihrer Bezeichnung Berlin Land II den Namen Berlins. Die Stadtsuperintendentur wurde im Anfang des 19. Jahrhunderts in die Superintendentur der Stadtgemeinden und Landgemeinden wiederum in zwei Verwaltungsbezirke.
Während so das Ringen um Gottes Wort und den glauben sich vollzog und das Innenleben, befreit von dem Druck der katholischen Kirche, in neue lichtvolle Bahnen einlenkte, waren in der Stille bedeutsame Veränderungen des irdischen Besitzes in unserem Ort vor sich gegangen.
Mit dem Tode des Kurfürsten Johann Cicero 1496, dessen Hang zum Vogelfang der Nachfolger auf dem Thron nicht geerbt hatte,war wahrscheinlich das Interesse der Hohenzollern an der kleinen idyllischen Besitzung in Pankow, dem Erkerhäuschen inmitten des Wallesgeschwunden. Sie überließen ihre Besitzung 1525 dem Dominicus Blankenfeld mit folgenden Lehnsbrief.[5]
„Wir Joachim Kurfürst bekennen und thum kundöffentlich mit diesem Brief für uns und unsere Erben und Nachkommen, daß wir unserem lieben und getreuenDiener und Hofgesindt Dominicus Blankenfeldt und seinen männlichen Erben zu ewigen Pachten gnädiglich geliehen haben, Die Stätte Raum und Grabenwallmit den vier (? unleserlich) und alles Zugehorung und Gerechtigkeit Grund und Boden die wir zum Dorf Pankow zum Besitz und eigen hatten auch allermaßen wie wir dies alles von unserem freundlichen lieben Herrn und Vater weiland Markgraf Johann Kurfürsten geerbt.“
[1] R. C., A. 11, 478
[2] Konsistorium Berlin.
[3] R. C. III, 502.
[4] Heidemann. Reformation in der Mark.
[5] St. Cop. Rep. 78, Nr. 26, Seite 197.
Folge 13
Das Erkerhaus aus Holz war dem Leibarzt Dr. Bartels zu Berlin zum Geschenk gemacht worden, welcher es auf seiner Besitzung in der Heiligen Geist-Straße an der Spree wieder errichtete.[1
Vierzehn Jahre später (1539) veräußerte die Familie Blankenfelde zwei Drittel ihrer Rechte in Pankow und allen Grundbesitz mit den halben Kirchenpatronat an den Rat zu Spandau, was der Kurfürst mit folgendem Lehnsbrief bestätigte:[2]
„Wir Joachim von Gottesgnaden Markgraf zu Brandenburg, bekennen, daß wir unseren lieben und getreuen Bürgermeistern und Rathmannen und Ihren Nachkommen unserer Stadt Spandow zwei theil am Dorffe Pankow, vor Berlin gelegen, mit seinen jährlichen Zinsen, Renten, Pächten, Diensten, Zehnden, Wassern, Wiesen, Grafungen, Hufen, Höfen, Holzungen, Byscherei, Streichern, Aeckern, gewonnen und ungewonnen, Huefnern, Cosseten samt der festen Hofstadt mit dem Walle umbfangen und anderen etlichen unerbauten Cossethenhöfen daselbst, auch binnen Zauns den ganzen Gericht, den halben Kirchenlehen, zusamt einer freien Schäferei mit ihren rechten, wie dieselben etwa vergangenen Jahren die Blankenfelde zu ihrer Zeit in Lehn empfangen, zu rechten mann-Lehen gnädiglich gelihen haben, in aller maßen wir die gemeldete zwei theil samt den angezeigten Gütern, vermöge des Kaufbriefes darüber ausgegangen von unsern lieben Hanßen Blankenfeld, Bürger in unserer Stadt Berlin, erblich erkauft, zu und an sich gebracht, welches auch derselbe Hanß Blankenfeld dem gedachten Rath alles auf seinem Behuff samt seiner ehelichen haußfrauen vor uns wie recht abgetreten hat.“
Wir kennen nicht die Veranlassung zu diesem Verkauf: doch da die Blankenfelde auch das Dorf Seegefeldt bei Spandau besaßen, so ist zu vermuten, daß der Verkauf in Pankow mit Regulierungen ihrer Besitzungen zusammenhing. Der magistrat zu Spandau hatte in diesem Kauf das halbe Patronat unserer Kirche 1539 erworben, wie es auch das Visitationsprotokoll von 1540 angibt. Das dritte Drittel des Besitzes an Pankow blieb der Familie Blankenfelde noch: jedoch erwarb es 1572 Simon Wellmann zu Berlin für 600 Taler.[3] 1578 kaufte derselbe Wellmann vom Magistrat zu Spandau das Gut mit allen Rechten und Zugehörigen für 2600 Gulden wieder zurück, so daß der ganze Besitztum in seiner Hand wieder vereinigt war.[4] Noch in demselben Jahrhundert ging das Gut wieder in den Besitz der familie Blankenfelde über
Diese Veränderungen im Besitz betrafen jedoch nur das Lehnschulzengut und die kleine Hohenzollernbesitzung mit ihren Rechten und dem Patronat, aber nicht das Belehungsrecht des Kurfürsten und das Besitzrecht des magistrats zu Berlin und Kölln. Aber auch hierin trat in diesem Jahrhundert eine bedeutsame Aenderung ein. Seit 1370 flossen infolge Verpfändung des Ortes die Abgaben für den Landesherrn in die Kasse der beiden Magistrate. An den Einnahmen unseres Ortes hatte Berlin 2/3, Kölln 1/3 Anteil. Zwischen beiden Räten bestanden nun schon lange Reibereien. Kölln beschuldigte Berlin, daß es bei der Verteilung der Erträge von den Dörfern, welche sie gemeinsam besaßen, übervorteilt würde, und drang auf gerichtliche Trennung der Besitzteile.Das führte 1543 zum Vergleich,[5] in dessen Protokoll es heißt:
„Hinwiderumb haben die Herren des Raths zu Coln iren dritten Teil und vormeinte Zusprach und gerechtigkeit an der berlinischen Seiten allenthalben am Buckshagen und in den dorffern Stralow Rosenfeldt P a n k o w Blankenborgh und Reinickendorff, Pauren, Hufen, Höfen, kornpacht, gelt und wasserzinsen,Zehnden, diensten, Holzungen, wassern, weyden u. s. f. hinfurder abzustehen und nichts mehr an der Berlinischen seyten und dorffern zu thun noch zu schaffen haben sollen.“
Wenn dieser Vertrag auch nichts in der Art und Höhe der Abgaben des Ortes änderte, so war doch das Rechtsverhältnis dahin gewandelt, daß das Dorf Pankow seit1543 nur noch Berlin gehörte. Am 25. Mai 1548 erwarb nun der Kurfürst Joachim II, vom Rat zu Berlin für 8400 Gulden „außer Besitzteilen in der Heide zu Spandau und den Plotcen Sehe (Plötzensee) alle Anteile des Rats an den Dörfern Berkholtz Pankow und Blankenburg mit aller und jeder zugehorungen zurück.[6] Wir können nicht entscheiden, ob bei diesem Rückkauf der dritte Teil, welchen Kölln besessen hatte, nicht mit eingegriffen war; es wird berichtet, daß der Kurfürst mit dem Rat von Berlin im Prozeß lag, vielleicht wegen dieser Rückkäufe. Der Erfolg war, daß der dritte Köllner Anteil an Pankow erst 1549 vom Rat zu Berlin auf den Kurfürsten überging.[7]
So war der Kurfürst wieder im Besitz der Einnahmen unseres Ortes, wie sie die Markgrafen vor 1370 besessen hatten.
Der Rückkauf des dritten Anteils war aber in anderer Beziehung von höchster Wichtigkeit. Indem Berlin alle Rechte an den Kurfürsten abtrat, erhielt es von diesem ein D r i t t e l d e r L e h n s h e r r l i c h k e i t ü b e r P a n k o w zugesprochen. Wir haben nur eine verkürzte Abschrift des Kaufbriefes, aus dem die Verleihung des Lehensrechtes hervorgeht, sie lautet:[8]
„Kaufbrief darin der Kurfürst ein drittel Teil an Pankow und Blankenfelde, so hierbevor der Rath von Berlin gehabt und an Kurfürst Gnaden verkauft, so hinwiederum den Blankenfeldern verkauft doch mit dieser Begnadung, daß der Rath von Berlin dominus foedi sein und diese Lehen zu verleihen haben soll.“
Seit 1549 war also neben dem Kurfürsten der Rat von Berlin ein drittel Teil Lehnsherr über Pankow. Jede Belehnung mit einem Hof oder Recht in unserem Ort mußte von nun an zu 2/3 vom Landesherren, 1/3 vom Magistrat Berlins erfolgen. Dieses Lehnsrecht ist auch tatsächlich bis zur Aufhebung der Lehnsuntertänigkeit 1810 vom Magistrat ausgeübr worden. Der kaufkontrakt, welchen 1680 von Grumbkow bei der Erwerbung des Lehnschulzengutes zu Pankow schloß, lautet am Schluß: „Weil auch das Dorf Pankow ein wiederkäufliches Lehen ist, davon 2 Teile zu hiesiger kurfürstlicher Lehnskanzlei, ein Teil aber beim Magistrat der Stadt Berlin zu Lehen geht, so will der Herr Käufer den Konsens sich selbst auf seine Kosten zu beschaffen bemüht sein.“[9] Auch wird dem Simon Wellmann vom Magistrat 1572 ein Lehnsbrief ausgestellt, in dem es ausdrücklich heißt: „Und wir, die Lehnsherren, erlauben und vergönnen gemelten Blankenfelde solches, konsentieren und bewilligen auch denselben Wiederverkauf in allen Punkten.“ Mit diesem Dritteil Lehnsrecht war der Anteil an der Belehnungsgebühr, welche gewöhnlich 2 % des Kaufpreises betrug, für den Magistrat verknüpft. So erhielt Berlin für den Verlust an Einnahmen aus unserem Dorf durch Abtretung des Köllnischen dritten Teiles einen Ersatz an Einnahmen aus dem Belehnungsrecht. Den von Berlin 1549 erworbenen Einnahmeanteil der Stadt Kölln gab Joachim in demselben Jahr der Familie Blankenfelde, [10] welche diese Einnahme 1572 bis zum Wiedererwerb des ganzen Gutes an Simon Wellmann veräußerten.[11] Durch diese der Familie Blankenfelde erwiesene Huld wuchs das Recht und die Einnahme des Gutes. Der Gutsherr bezog von da an den Zehnt, den Grundzins und das Kaufgeld der Höfe.
Bei den Wiederkauf der Anteile Berlins und Köllns an Pankow war das Patronatsrecht Berlins noch nicht erloschen. Obwohl die Familie Blankenfelde das ganze Gut um 1600 wieder besaß, werden in einer Matrikel von 1600 (Konsistorium Berlin) als Collatores, d. h. Patrone noch der Rat von Berlin und Spandau und die Blankenfelde genannt. Infolge der vielen Besitzänderungen in diesem Jahrhundert sind die Patronatsverhältnisse in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts nicht klar. Die folgenden Besitzer des Lehnschulzengutes dagegen werden nicht mehr mit dem halben, sondern mit dem ganzen Kirchlehen belehnt.
Noch eine Belehnung mit Besitz in Pankow, welche Interesse hat, ist uns aus diesem Jahrhundert bekannt, sie betrifft die Familie Brietzke. Eggert Brietzke starb 1527 und seine Söhne leisteten den Lehnseid.[12] Diese Familie war reich begütert. Sie hatte Besitzungen in Rudow und Teltow,[13] in Wulkersdorf, Wendisch-Gothkow, Schönhagen, langenwische und Jemlin.[14] 1542 wird nun diese Familie mit weiteren Besitzungen in Pankow belehnt[15],und zwar mit 15½ Hufen, einem Viertel am Gericht und mit einer W a s s e r m ü h l e, b e l e g e n i m D o r f. Hier wird zum erstenmal die Wassermühle erwähnt, welche bis 1839 an der Panke, in heutigen Bürgerpark, lag, welche in späterer Zeit und vielleicht auch schon damals ein bedeutendes Industriewerk, eine Papiermühle, war und bisweilen gegen 60 Arbeiter beschäftigte. 1750 besaß diese Mühle Michael Schwiegerlink,[16] später Pickerin, 1825 brannte sie ab und wurde, von neuem wieder erbaut, 1839 durch die durch plötzliche starke Gewitterregen angeschwollene Panke zerstört.
[1] Peter Hafft. R. C. IV Seite 75
[2] St. Cop. R.78, 35. R. C. Suppl. I 355.
[3] Rathaus Berlin „Dörfer und Ländereien“. Seite 243
[4] Rathaus Berlin „Dörfer und Ländereien“. Seite 245
[5] Rathaus Berlin. Archiv XI,105.
[6] Stadtarchiv.
[7] R. B. „Dörfer und Ländereien“, Seite 210
[8] R. B. „Dörfer und Ländereien“, Seite 210
[9] Rathaus Berlin, „Dörfer und Ländereien“.
[10] Ebenda Seite 243.
[11] Ebenda Seite 210.
[12] St. Cop. Nr. 34.
[13] Cop. R.78. 42.
[14] Cop. R. 78, 35.
[15] Cop. R. 78, 35.
[16] Kirchenbuch.
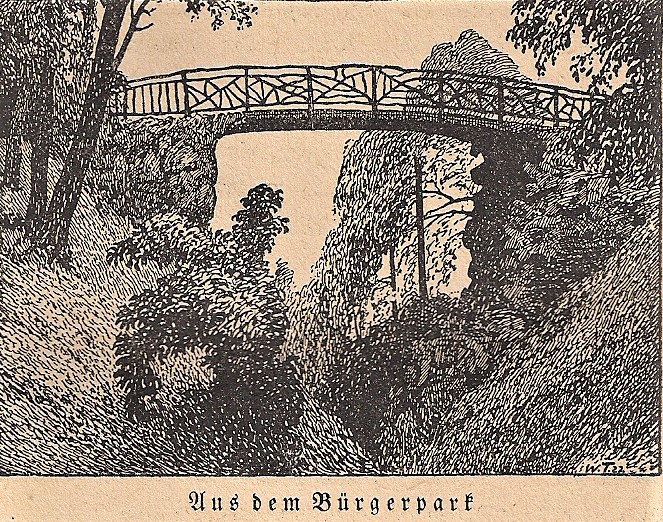
Was war Pankow am Ende dieses gewaltigen Jahrhunderts? Ein Dorf reicher Besitzer, aber rechnen wir den Hufenbesitz des Gutes, der Familie Krusemark, der Brietzke und der Pfarre zusammen, so ergibt sich der Schluß, daß nur eine kleine Hufenzahl den Bauern geblieben war. Die 12 Bauernhöfe und 15 Kossätenhöfe, welche 1624 das Schoßregister der Zahl nach angibt, waren zum großen Teil wüst und zerfallen und im Besitz der Berliner, so hatte z. B. Krusemark vier wüste Höfe übernommen, und das Visitationsprotokoll sagt, daß der Bauer thewes Dene seinen Zins nicht zahlen kann. Der Bauernstand war verfallen und verarmt.
Die Pfarrer des Jahrhunderts der Reformation waren Johann Moller, dessen Todesjahr wir nicht kennen, Zimmermann, Andreas Kornemann, gestorben 1596, und Andreas Kurtzmann, gestorben 1600.
Folge 14
1600 – 1700
Wenden wir uns dem Jahrhundert des Dreißigjährigen Krieges zu, so vermuten wir von vornherein, daß auch über unseren Ort Plünderung und Verwüstung kam(en). Die Mark hat in den Jahren 1620-28 schwer gelitten. Brandenburg war zu schwach, um sich Feinden gegenüber halten zu können; es war deshalb Freunden und Feinden win willkommener Ruheplatz. Die Mark wurde ausgesogen. Dänische Truppen hatten mit den wilden Scharen Mansfelds vereint hier schrecklich gewirtschaftet, beliebig Steuern erhoben und gebrandschatzt. Da kam die kaiserliche Armee unter Wallenstein, vertrieb die Mannsfelder und Dänen und machte sich in der Mark ein bequemes Lager; diese Regimenter waren als Peiniger und Bedrücker gefürchtet. Wallenstein hat um 1627 im Kreise mit seinen Horden furchtbar gehaust. Auch in unserem Ort war gewiß Einquartierung, Bedrückung und Erpressung an der Tagesordnung. Der Kurfürst Georg Wilhelm war gezwungen, dem damals allmächtigen Wallenstein alle Forderungen zu bewilligen; er übernahm seine Bewirtung und hielt den ganzen Troß desselben frei. Drei Jahre blieben die kaiserlichen Truppen in der Mark (1626-28), denn Wallenstein rüstete sich zu dem für ihn so verhängnisvollen Zug nach Stralsund. Man fürchtete im geheimen, daß er, der Mecklenburg schon in der Tasche hatte, Brandenburg an sich reißen würde. Das kleine Berlin – es zählte damals 10 000 Einwohner in 1209 Wohnhäusern – nahm am 22. Juni 1628 Wallenstein selbst als gefürchteten Gast auf. Ein glänzender Einzug wurde ihm bereitet. Auch die Einwohner Pankows mögen nach Berlin geeilt sein, um diesen Heerführer auf weißem Roß, begleitet von 30 Fürsten und Grafen und einem Gefolge von 1500 Köpfen zum Stralauer Tor einreiten zu sehen. Am 23. Juni zog er, an Pankow vorüber, seinen Truppen nach Eberswalde nach.
Auch Gustav Adolf soll auf dem Wege nach Spandau durch Pankow gekommen sein.
Die Not wurde immer größer. 1632 zog der schrecklichste Feind, die Pest, ein. Der Landreiter berichtet nach den Schrecken des Dreißigjährigen Krieges aus dem Jahre 1652, daß die Hälfte der Bewohner unseres Kreises entflohen oder umgekommen war, die Felder lagen verwüstet, Dornen und Disteln hatten überall die Herrschaft angetreten. Unser Ort hatte manchen Sturm schon erlebt, aber so schwere Schläge und so tiefe Wunden hatte der Bauernstand noch in keinem Jahrhundert empfangen. Man lese den Revisionsbericht der Dörfer unseres Kreises vom7. Mai1696, welcher den Zustand unseres Dorfes fünfzig jahre nach dem Friedensschluß schildert. Noch nach einem halben Jahrhundert sind vier Bauernhöfe und acht Kossätenhöfe zerfallen, wüst, unbesetzt, Bauern können ihre Abgaben nicht mehr zahlen und werden Kossäten, Kossäten müssen in das Tagelöhnerhaus auf das Gut ziehen, und der Schäfer nutzt einen Kossätenhof, damit dieser nicht noch mehr zerfällt. Von 15 Kossätenhöfen sind 8 wüst und nur 3 von Kossäten besetzt. Der Kaufkontrakt zwischen Amtsrat Weise und Geheimen Tat Grumbkow 1680 enthält die traurige Tatsache, daß drei bauern ihre Pächte noch schulden, daß drei Kossäten je 44 Taler Kaufpreis schuldig sind, und daß der Gutsherr ihnen Pferde und Kühe samt einer Hufe Sommer- und Wintersaat hat geben müssen. Ferner lesen wir im Kaufkontrakt von 1690 zwischen den Grumbkowschen Erben und dem Kurfürsten, daß drei Bauernhöfe und acht Kossätenhöfe noch wüst und unbesetzt sind, und nur drei Kossätenhöfe Besitzer haben. Welch ein trauriges Bild unseres Ortes schaut uns hier an, und wie mag es erst fünfzig Jahre früher im Ort gewesen sein.
Der Revisionsbericht[1] lautet:
Pankow soll haben 38 Hufen
12 Hüfner
15 Kossäten
1 Schmied
1 Hirt
Hufen.
2 Christoph Müller wohnt auf einer Kossätenstelle
2 Michel Schaum auf Bartel Meyers Hof
2 Peter Ohm
2 Peter Krafft wohnt auf einer Kossätenstelle
2 Der Krüger Bartel Zernikow, die dritte Hufe hat Adam Schwitzke
2 Peter Wartenberg
2 Martin Puhlmann wohnt auf einer Kossätenstelle
2½ Adam Schwitzke
4 Matthes Meyer
2 Martin Liedemit
3 Martin Grunow
4 Martin Schaum
3½ Martin Zwarg
3 Jürgen Liebnitz
1 Zu Michel Schaums 4 Hufengut hat der Schäfer unterm Pflug.
Bewohnte Kossäten sind
- Hans Külige.
- Andreß Göris.
- Albrecht Knopf.
- Henry Noah.
- Herr Stoßius.
- Barthel Lafosse.
- David Illlarie.
Wüste Kossäten sind
- Worauf Martin Puhlmann.
- Der Bauer Christoph Müller.
- Peter Krafft.
- Martin Lindemit. Diese 4 Bauern wohnen auf Kossätenstellen.
- Jürgen Dreyers nutzet Jürgen Liebnitz.
- Andres Schmidt hat Christoph Müller.
- Matthes Mohrmann wüste Hof soll der Schäfer nutzen.
- Auch Tewes Wernicke genannt, ist in den Garten gezogen.
In diesen Bericht ist das Gut nicht mit aufgenommen, auch ist nicht berücksichtigt, ob die Hufen zum Hof gehörig oder nur Pacht sind; denn nach dieser Angabe bleiben nur 4 Hufen übrig, was für die Pfarre und das Gut nicht ausreicht.
Die unter4, 6 und 7 genannten Kossäten waren französische Einwanderer. Der große Kurfürst hatte den um ihres Glaubens willen aus Frankreich geflüchteten Hugenotten sein Land 1685 geöffnet und den Landleuten unter ihnen verlassene sogen. wüste Kossätenhöfe angewiesen. – Auch Pankow hatte an diesem großen Liebeswerk Anteil. So hatten in Pankow David Illarie, Barthel Lafosse, Henry Noah oder Noé, Jacob Siergen 1695 je einen Kossätenhof gemietet.[2]
Der vom Landreiter Nr. 5 genannte „Herr Stoßius“ war der Amtshauptmann von Nieder-Schönhausen von Stosch, welcher den Kossätenhof, den heutigen Amalienpark, 1691 innehatte.[3]
Im Pfarramt folgten dem Pfarrer Jeremias Wittkenius 1600–1624 die Nachfolger schnell aufeinander. Joachim Fuchs 1624–26, Sebastian Hein 1626–28, Martin Langhorst 1628–50, Christopf Beccig 1650 zum erstenmal,Daniel Bernhardi 1650–54, Christopf Beccig 1654–63, Martin Pepusch 1663–89, Christoph Ideler 1689–1729. Also neun Pfarrer in einem Jahrhundert. Was mögen sie unter dem Druck des Dreißigjährigen Krieges und seinen schweren Folgen an Not und Entbehrung durchgemacht haben. Das Einkommen war gering und bestand zum größten Teil aus den Hufenabgaben. Aber wie oft blieb die Scheune leer, denn alle Aecker waren wüst, und die Bauern konnten das Meßkorn nicht liefern. Wie alle Dorfhäuser war auch das Pfarrhaus erbärmlich, ohne Unterkellerung, in Fachwerk erbaut, und ebenso wie die Scheune der Ausbesserung bedürftig. Da die Bauern und Kossäten über den Hand- und Spanndienst, welchen sie wöchentlich dem Gutsherren leisten mußten, schon hart seufzten, so waren sie gewiß auch wenig bereit, dem Pfarrer die notwendigen Dienste zu leisten. Pfarrer Pepusch berichtet im Kirchenbuch 1664 als ein besonderes Ereignis: „In diesem Jahr ist das Pfarrgehege zugemacht, von den Pankowschen allein, doch nicht ganz und zum Theil mit alten Stöcken, Desgleichen auch die Scheune gedeckt auf einer Seite. Die Schönhausenschen haben nur einen Tag geholfen.“[4] 1665 „neuer Torweg und Brunnenstiel.“[5]
[1] Landratsamt Niederbarnim.
[2] A. M.
[3] A. M.
[4] Kirchenbuch 1664.
[5] Kirchenbuch 1665
Folge 15
Es ist von Interesse, das Ortseinkommen der Pfarrers und Küsters, wie es vor 200 Jahren war, genauer kennenzulernen. Mancher kirchliche Brauch und die engen Beziehungen des Pfarrers zur Gemeinde in der alten Zeit wird uns gleichzeitig dadurch bekannt. Pfarrer Ideler berichtet aus dem Jahre 1716:
Pfarre
W o h n h a u s nebst Scheune, notdürftige Stallung und ein kleines Häuschen zur linken Hand auf dem Hof, welches er selbst sich erbaut hat aus eigenen Mitteln
3 G ä r t e n in Pankow. 1. hinter dem Haus. 2. ein Kohlgarten auf dem Feld hinter Grunows Hof. 3. ein Kohlgarten, den er wegen seiner Nässe zur Wiese gebraucht.
A c k e r. 4 Hufen in den 3 Feldern mit den Beiländern 1. In dem großen Felde nach Blankenburg zu. 2. Die zwei hintersten Hufen liegen beisammen, darüber der Berlinische Weg geht. 3. Die mittelste 2te Hufe zu 4 Enden, und hinter des Krügers Garten auch 2 Breiten zu 4 Enden, welche halb geteilt das 3te Feld hinter den Höfen von der Wichsling an machen. Die Beiländer sind zusammen zwei breite Stücke, 3 Ober Erbsstücke, 3 kleine Länder, 2 Steinberge, 2 Wischstücken, 2 lange Mittelbrüche, 3 hunerstorfsche Stücke, 5 Unter Erbsstücke, 4 Mühlenstücke. 10 Berkholz Enden, darunter zwei wüstbewachsen, 5 Heynholz Stücke und 6 Enden hinter den Höfen.
W i e s e n. 5 Wiesen, die kleine Schilfwiese, die Große, die Neue, das Radeland, den Fuchswinkel.
G e l d. K e i n Zehnd sondern rein Korn von jeder Hufe ein Scheffel sind 1 Wispel 14 Scheffel. Den halben Bierzeitenpfennig, die andere Hälfte beziehen die Kirchenvorsteher zum Einkauf der Oblaten und des Weines. (Was bei dem Einkauf an Geld übrig war gehörte auch dem Pfarrer nach einer Verfügung des Konsistoriums vom 25. Juni 1667.[1])
Aus der Kirchenkasse jährlich ein Taler Strohgeld. (Die Lieferung von 1 Schock Bundstroh von jeder Hife[2]) war in den Nöten des Dreißigjährigen Krieges offenbar eingestellt worden und wurde zum Schaden des Pfarrers mit 1 Thaler aus der Kirchenkasse ersetzt.)
F l e i s c h z e h n t. Von zwei Bauernhöfen a Puhlmann später Soldmann b Peter Krafft später Borcherdt je ein Huhn oder 8 Pfennig.
In der Vokation vom Patron jährlich als Legat vermacht 20 Thaler (welche er jährlich von Grumbkow und danach seit 1691 vom Amt Nieder-Schönhausen bezog).
Accidentien
A u f g e b o t 6 Groschen
T r a u u n g 1 Thaler, agendarische Trauung 12 Groschen. Wenn besonders geschlachtet wurde, die Ochsenzunge und die vier Füße mit einem Stück Rindfleisch, wurde nicht geschlachtet dann hierfür 12 Gr. Ein Schnupftuch eine Citrone; dazu am nächsten Tag Frühstück und Mahlzeit; sowie das Opfer des Jungfernganges dabei sie und ihre Mädchen opfern dazu an diesem Tag die Mahlzeit oder 6 Gr.
T a u f g e l d. Die welche Meßkorn geben, zahlen nicht. Hirt, Schmidt, Tagelöhner geben 6 Gr. Und für jeden Gevatterbrief 1 Gr. Die Wöchnerinnen geben Opfer 2 Gr. In die Hand und mit den Frauen die mit ihr gehen ein Opfer auf dem Altar und auch eine Mahlzeit.
B e e r d i g u n g. Für den Gang (vom Haus zur Kirche) 6 Gr. Und Opfer, welche Meßkorn geben, die nicht Korngabe abliefern müssen geben 12 Gr. Für die Leichenpredigt ein Thaler und die Trauermahlzeit, für die Leichenabdankung (am folgenden Sonntag) vor dem Altar 12 Gr.
P r i v a t – K o m m u n i o n 6 Gr.
Er hat die Mahlzeiten bei Hochzeiten, Jungferngang, Taufen und Kirchgang oder 6 Gr. Dafür.
S c h e i n e. Für jeden Schein 6 Gr.
Beichtgeld. Keines
K i r c h e.
- Hat einige Enden Gottesland in allen 3 Feldern so die Kossäten beackern und davon jährlich 9 Thaler geben. Noch ein anderes Ende, davon Kossäten 3 Thaler geben, ein Schwad Wiesenwachs giebt jährlich 2 Gr.
- Kein Bierzeitengeld.
- Klingelbeutel und Büchsengeld soweit letzteres nicht den Armen zugeteilt wird.
I n v e n t a r: Leuchter, Kelch, Flasche, Klingelbeutel, Orgel mit 3 Zügen, welche 1710 angeschafft wurde. Auf dem Turm drei Glocken, das messingene Taufbecken.
A n b a r e m Gelde: 263 Thaler, 19 Gr. 8 Pf.
K ü st e r e i
- H a u s mit Garten und im Haus ein Viehstall, vor dem Hof ein Schweinestall so er sich selbst erbaut hat auch den Garten mit eichenen Planken besetzt.
- K o r n. 1 Wispel und 9 Scheffel soll dazu 54 Brote aus Pankow haben, welche er aber niemals alle bekommen.
G e l d: 2 Groschen zur Glockenschmiere, 4 Groschen für Klingelbeuteltragen und 2 Thaler für sonstigen Kirchendienst (der Küster muß zu allen Amtshandlungen mit dem Pfarrer nach Schönhausen gehen).
A c c i d e n t i e n.
T r a u u n g: 1 Gr. Und Mahlzeit.
T a u f e n: Nur von Fremden 3 Groschen.
K i r c h g a n g der Wöchnerinnen: 1 Groschen und Mahlzeit.
P r i v a t k o m m u n i o n: 3 Groschen.
B e e r d i g u n g: Ganz zum Haus und zur Kirche 3 Groschen. Für Singen der Lieder vor der Tür 1 Groschen; bei Fremden 6 Groschen. Bei der Abdankung ebenso. Bei der Leichenpredigt auch drei Groschen.
S c h u l g e l d. Im Winter 6 Pf. Pro Kind pro Woche, im Sommer kommen gar keine.
Empfängt zur Mahlzeit bei Hochzeiten, Taufen Kirchgang noch 3 Groschen.
Bei dem Jungferngang wo er nicht gespeist wird, 3 Groschen.
Für das Einfordern des Bierzeitengeldes 1 Gr. Für Pankow und Schönhausen.
Die früheren Einnahmen vom Wedding sind im Einkommen der Pfarre nicht mehr erwähnt. Der Wedding, welcher am 1. September 1648 vom Kurfürsten wieder erworben war, muß gegen Ende des Jahrhunderts zu Berlin gelegt worden sein; in den siebziger Jahren erwähnt das Kirchenbuch zu Pankow noch Amtshandlungen, welche der Pfarrer zu Pankow verrichtete.
Aus dem Jahr 1604 stammt unser schöner Abendmahlskelch von herrlicher geklopfter Arbeit, ein Meisterstück der Silberschmiedekunst; um diesen Kelch haben sich in jenen Kriegsnöten die Bewohner gesammelt, allen Plünderungen war er entgangen, verwahrt von treuen Händen.
Auf die Art der Gottesdienste jener Zeit in Pankow und Nieder-Schönhausen wirft eine Anordnung[3] vom 21. Februar 1654 Licht. „Der Pfarrer zu Pankow soll in dem filial Schönhausen zum wenigsten alle Viertel Jahr das v o l l e Amt halten, auch zum wenigsten alle 8 Tage es vorher ankündigen, und die Zuhörer in der Katechismuslehre fleißig unterrichten, weßhalb denn die im filial Nieder-Schönhausen nicht eben nach Pankow zu ihm kommen dürfen, sondern ihm liegt ob, solches zu Schönhausen als in dem ordinair Kirchenspiel zu verrichten.“ Die Reformation hatte auf die Unterweisung der Alten und Jungen im Katechismus den größten Wert gelegt, zumal der Schulunterricht äußerst mangelhaft war und die Lehrer fast immer nur Handwerker waren. Infolgedessen waren die Gottesdienste zum großen Teil nur Unterredungen und Belehrungen im Katechismus. Die Gefahr lag nahe, daß die Predigt, die Verkündung des Gotteswortes, nicht zu ihrem Rechte kam. Da nun Pankow damals etwa 250 Bewohner, Nieder-Schönhausen etwa 150 Einwohner zählte, so mögen die Pfarrer oft beide Gottesdienste in einem vereinigt und die Schönhausener zur Kirche nach Pankow geladen haben. Diesen Mißstand hebt die Verordnung auf und bestimmt, daß wenigstens alle Vierteljahr „ein volles Amt“, das heißt Predigtgottesdienst und Abendmahl im Filial gehalten wird und sonntäglich Katechismuslehre in dortiger Kirche stattfindet.
Folge 16
Zur Erhöhung des geringen Einkommens des Pfarrers mußte etwas geschehen. Schon 1680[1] hatte der Patron von Grumbkow nei der Berufung des Pfarrers Ideler diesem einen jährlichen Zuschuß von 20 Talern vom Gut bestimmt. Diesen Zuschuß bezog der Pfarrer auch später vom Amt, als der K u r f ü r s t Patron wurde. Da starb 1689 in Blankenfelde Hindenburg, Pfarrer von Blankenfelde und Schildow, und gleichzeitig Pfarrer Martin Pepusch von Pankow. Da Geheimrat Grumbkow Patron von Pankow, Nieder-Schönhausen und Blankenfelde war, so wurde mit Genehmigung der behörden die Pfarrstelle von Blankenfelde nicht mehr besetzt, sondern nach Abtrennung von Schildow, welches zu Schönerlinde gelegt wurde, Blankenfelde dem Pfarrer von Pankow überwiesen. Dadurch wuchs die Arbeit des Pfarrers allerdings bedeutend. Blankenfelde war eine Mutterkirche, in welcher sonntäglich Gottesdienst gehalten werden mußte. Da Pankow und Schönhausen dicht nebeneinader liegen, so fand in diesen Orten hinfort nur abwechselnd an den Sonntagen Gottesdienst statt. An den Festtagen hielt der Pfarrer in allen drei Kirchen den Gottesdienst. Die Verbindung der beiden Pfarreien zu einer brachte eine bedeutende Erhöhung des Einkommens für den Pfarrer zu Pankow mit sich und erhob die Pfarrstelle unseres Ortes zu den gut dotierten, obgleich sie, wenn alle Einnahmen wirklich einkamen, auch erst 500 Taler Gehalt gewährte.[2]
Wir müssen noch einmal auf den Anfang des Jahrhunderts zurückgreifen und die Frage nach den Besitzer des Gutes und des Patronats beantworten. Die Familie Blankenfelde, welche am Ende des vorigen Jahrhunderts die Besitzungen in Pankow zurückerobert hatte, veräußerte dieselben am 1. Februar 1624 mit allen Einnahmen und Rechten und dem Patronat der Kirche an den Landrentmeister Berchelmann, in dessen Familie sie bis1680 verblieben. Berchelmann erwarb sich vielfach den Dank der Gemeinden. Er schenkte der Kirche einen kunstvoll gearbeiteten Tauftisch aus Holz, dessen Reste noch lange in unserer Zeit im Turm aufbewahrt standen; er ließ 1624 das Innere der Kirche restaurieren und versah den Altarraum mit gemalten Altarfenstern, welche sein und seiner Gattin, Rosine Steinbrecher, Wappen trugen. Letztere stammte aus einer reichen Berliner Familie, welche in der Heiligen geist- und Kloster-Straße ihren Sitz hatte. Diese Fenster mit Wappen sind 1858 bei dem Umbau der Kirche erst entfernt worden.
Den Besitz des Gutes erbte der Schwiegersohn Arzt Dr. Weise und nach dessen Tod der Enkel Kammerrat Weise.
1680 ging das Gut und Patronat in den Besitz des Geheimen Kriegsrats von Grumbkow über. Der Kaufkontrakt, welcher uns Kenntnis auch der früheren Verkäufe gibt lautet:[3]
„Generalkommissarius und Geheimer Kriegsrat von Grumbkow kauft vom Kammerrat Herrn Weise das Dorf Pankow mit allen seinen Rechten und Gerechtigkeiten, mit Ober- und Untergericht, Kirchlehen, Zinsen, Pächten und ihm zustehenden Diensten, Ackern, Wiesen, Triften etc., alles wie solches seinem Großvater, dem damaligen Landrentmeister Joachim Berchelmann vermöge Kaufkontrakts vom 1. Februar 1624 von George und Wilhelm Blankenfelde wiederkäuflich und im Pausch zugeschlagen vor 6000 Thaler, der Thaler zu Vier und zwanzig Groschen gerechnet Weil auch dieses Dorf Pankow ein wiederkäufliches Lehen ist. Davon Zwei Teil zu hiesiger kurfürstlicher Lehnskanzlei, ein Teil aber beim Magistrat der Stadt Berlin zu Lehn geht, will der Herr Käufer den Konsens sich selbst auf seine Kosten zu beschaffen bemüht sein u, s, w.“
Der Kontrakt zählt weiter das tote und lebende Inventar auf, was beweist, daß auf dem Gut die Landwirtschaft intensiv betrieben wurde, und berichtet zuletzt von der Abgabenpflicht der zum Gut gehörigen Bauernhöfe und des Krugwirtes und erwähnt die Namen der drei besetzten Kossätenhöfe Martin Puhlmann, Matthias Meyer, Andreas Göris.
Enorm sind die Abgaben der zugehörigen Bauernhöfe an das Gut, zu denen doch noch das meßkorn an die Pfarre und der Grundzins kamen.
Thomas Liebnitz 3 Wsp. 6 Sch. Roggen, 1 Wsp. 16 Scheffel Gerste.
Martin Zernikow 5 Wsp. 10 Sch. Roggen, 3 Wsp.11 Sch. Gerste.
Adam Blisse 4 Wsp. 2 Sch. Roggen, 2 Wsp. 7 Sch.Gerste.
Peter Wartenberg 2 Wsp. 15½ Sch. Roggen, 1 Wsp. 10 Sch. Gerste.
Krugwirt hans Jänicke 3 Wsp. 12 Sch. Roggen, 3 Wsp. 2 Sch. Gerste.
Tiefere Einsicht gibt uns noch der Lehnsbrief,[4] welchen der Kurfürst Friedrich III. bei seinem Regierungsantritt dem von Grumbkow von neuem am 22. Februar 1690 ausstellte. Bei jedem neuen Regenten mußten die Lehnsbriefe erneuert werden, natürlich unter Entrichtung der Lehensgebühr. Aus dem Lehensbrief erfahren wir, daß von Grumbkow außer „dem Gut“ Pankow noch „den freien Rittersitz“ Nieder-Schönhausen samt dem Kirchlehn (Patronat) das „Summet Holtz“ (Summt) und Blankenfelde erwirbt. Auf Pankow bezieht sich folgende Stelle:
„Item das Guht Panckow mit Ober und Unter gerichten, Kirch-Lehen, Zinsen, Pächten, Diensten, Aeckern, Wiesen, Triften, Teichen, Gärten, Büschen, Feldern, Wohnungen,Meyerei, Schäferei, und anderen Pertinenzien, sowie das mehr Hochgedachtes unseres Vaters Gnaden dero Raht und Lib Medico Dr. Weißen geschenkt oder was derselbe nachgehends dazu erkauft, seine vier besetzten Bauer so wöchentlich 2 tage Spanndienste thun, im Augustvierteljahr aber, als von Johannis bis Michaelis wöchentlich 3 tage dienen; frei wüste bauernhöfe, drei besetzte Kossäten, acht wüste Kossäten und die Pächte und Dienste von den Unterthanen.“
Wie groß waren die Rechte des Gutsherrn, welcher von 7 Bauernhöfen und 11 Kossätenhöfen Kaufgeld und hohe Jahrespacht einzog und über ihre wöchentlichen Hand- und Spanndienste verfügte. Wir erinnern uns der Ver(t)eilung von 1370, da gehörten zum Schulzenhof nur 9 Kössätenhöfe. Die Huld der Kurfürsten hatte die Blan(k)enfelde und, wie dieser Lehnsbrief sagt, den Leibarzt Dr. Weise immer mehr bedacht. (Anm. Hrsg.: ( ) = unleserlich; verdruckt)
Die übrigen 5 Bauernhöfe waren dem Gut nicht zu Hand- und Spanndiensten verpflichtet.
Geheimrat Grumbkow setzte die Verschönerung des Gutshofes fort und machte ihn zu einem herrlichen Sommersitz, auf dem zur Linken und Rechten eingeschlossen von Gärten an der Dorfstraße das stattliche Wohnhaus, später allgemein Amtshaus, auch Freihaus genannt, erstand. Die Gärten wurden besonders gepflegt und in ihnen künstliche Teiche und Inseln angelegt. Der eine Garten, nach der Pfarre zu, führte später direkt den Namen „die Insel“. Damals sind wohl auch die herrlichen baumreihen in der Dorfaue jetzt (Breite Straße) [recte: (jetzt Breite Straße)] erstanden.Die Reihen setzten sich nach einer Karte vom Jahre 1818 östlich der Kirche fort.
So lag Pankow gebettet im Grünen und zog immer mehr Berliner Besitzer an.
In dem Kaufkontrakt zwischen den Grumbkowschen Erben und dem Kurfürsten 1691 wird die Höhe des Verkaufspreises ausdrücklich mit den großen, durch Grumbkow geschaffenen Verschönerungen motiviert. Aus diesem Jahrhundert haben wir die ersten genaueren Angaben über die namen der Bewohner des Ortes. Der Revisionsbericht von 1696 und das Kirchenbuch, 1660 beginnend, nennen sie uns. Im Ort waren 12 Bauern und 15 Kössäten. Martin Puhlmann, Christoph Müller, Martin Liedemit, Peter Krafft, Michael Schaum, Peter ohm, Bartel Zernikow, Peter Wartenberg, Adam Schwitzke, Matthias Meyer, Martin Grunow, Martin Schaum, Martin Zwarg, Jürgen Liebnitz, Adam blisse, Hans Jaenicke, Andreas Köris.
Küster und Schullehrer waren Gabriel Neuenhagen bis 1666, Christoph Seifert 1666–89, Martin Brederecke , ein Leinweber, 1689–1701. Im bescheidenen Küsterhaus neben der Kirche haben sie gewohnt, das Gärtchen bestellt, ihr Handwerk betrieben, die kleine Schar der Dorfkinder in enger Stube während des Winters im Lesen, Schreiben und Rechnen unterrichtet, manches Gebet und Gebot gelehrt, und mit den Dorfleuten die Nöte des Jahrhunderts durchlitten; treu standen sie ihrem Pfarrer bei allen Amtshandlungen zur Seite, verrichteten den Dienst in der Kirche in Pankow und Schönhausen, sangen die Toten zu Grabe und halfen mitessen, wenn Freudenfeste die Glieder einer Familie vereinten; sie holten am Ostertag von den Höfen ihre Eier zusammen und jahrein jahraus ihre Brote; sie sammelten das Vierzeitengeld, den vierteljährlichen Abendmahlspfennig. Sie waren so der Jugend Lehrer und der Alten vertrauter Freund und Handwerksmeister.
[1] Designation von 1716. Konsistorium.
[2] Einkommensnachweis von 1716.
[3] Rathaus Berlin, „Dörfer und Ländereien“.
[4] St, Cop. Rep. 78, Nr. 188
Folge 17
1700-1800. Die Hohenzollern als Gutsherren.
Der Schluß des Jahrhunderts brachte unserem Dorf eine große Freude und Ehre. Der Kurfürst wurde Gutsherr in Pankow. Er kaufte 1691 von der Witwe des Geheimen Rats von Grumbkow das Gut Pankow und das Rittergut Nieder-Schönhausen für 16 000 Taler. Der Kaufkontrakt lautet:
- 1.
Es verkaufen an höchstgedachte Seine Kurfürstliche Durchlauchtigkeit zu Brandenburg die zu Ende dieses Kontraktes benannte Frau Wittwe wie auch Tutores und Curatores der unmündigen und noch minderjährigen Kinder und Erben des weiland gewesenen Kurfürstlichen geheimen Raths und Oberhofmarschall des von Grumbkow, die beiden Dörfer Nieder-Schönhausen und Pankow mit allen und jeden dazu gehörigen Rechten und Gerechtigkeiten an Aeckern, Teichen, Hütungen und Triften, Gebäuden, Unterthanen von Mann Zinsen Dienstgelder und Pächten, Summa mit allen und jeden dazugehörigen Pertinenzien, sie haben Namen wie sie wollen, nichts überall davon ausgenommen, für eine Summe von Sechszehn Tausend Thaler, welche höchstgedachte seine Kurfürstliche Durchlaucht als Käufer sofort bei Vollziehung des Kontraktes und Tradition der Güter durch Herrn Geheimen Kammerdiener Stoschinum baar zu erlegen, hiermit und in Kraft dieses versprochen.
- 2.
Und ob zwar die zur Untersuchung dieser Güter verordneten Amtsräte und Kommissarii berichtet, wenn nach Proportion der Einkommen das Kaufgeld ad 5 pro Cent angeschlagen werden sollte, der Preis dieses Gutes, ohne die Gebäude, Garten, Graben und andere Meliorations-Kosten, welche der verstorbene Geheime Rath und Obermarschall der von Grumbkow in sehr konfiderablen Summen daran verwandt, nicht höher als auf vierzehntausend siebenund achtzig Thaler zwanzig Groschen Kapital sich belaufen würde, so haben doch höchstgedachte Durchlaucht in gnädigster Erwägung gedachter großer Kosten, welche zu Einrichtung dieser Güter verwendet, das Kaufpretium derselben auf vorbesagte Summe vollbedürftig eingerichtet, und wollen solche sofort bei Tradition der Güter vorgedachtermaßen baar auszahlen lassen.
- 3.
Weil aber auch gedachte Güter mit schönen zierlichen Gebäuden, Garten, Plantagen und sonstigen vom verstorbenen Ober-Marschall ausgezieret, welche demselben ein ansehnliches gekostet, ob sie wohl keine wirklichen intraden einbringen, so haben höchstgedacht seine Kurfürstliche Durchlaucht wegen der bequemen und nahen Situation dieser Güter, worauf sie zuweilen dero divertissement nehmen könne, wie auch in grädigster consideration, daß diese Güter pupillis und minorennibus zustehen, deren Herrn Vater Kurfürstlichen Angedenkens viele treue und nützliche Dienste geleistet, eben die vorgedachte Sechzehntausend Kaufgelder zu zahlen versprochen.
- 4.
Kosten und Ausfertigung.
- 5.
Gewährleistung.
- 6.
Dokument sollen extradirt werden.
- 7.
Vorbehalt wegen einiger Früchte der letzten Ernte.
- 8.
Pacht und Zinsen gehen vom künftigen Michaelis ab.
- 9.
Mit Berlin hatte sich von Grumbkow verglichen, daß nicht von Berlin sondern von Blankenfelde beide Dörfer ihr Bierentnehmen dürfen.
- August 1691.[1]
Besondere Hoffnungen erfüllten aller Herz, als sie ihren Allergrädigsten Herrn auf dem Gutshof und gewiß auch in ihrer Kirche sahen, jeder erhoffte etwas für sich. Freude und Stolz wuchsen wohl noch, als ihr Gutsherr Friedrich III. 1701 sich die Königskrone aufsetzte und die Diener des Gutes vom Amtmann bis zum Schäfer auf der Schäferei sich „königlich“ nennen konnten.
Die Herrscherfamilie hat nie auf dem Gutshof in Pankow in den Sommermonaten gelebt. Den Hof verwaltete ein Amtmann, weshalb dem Gutshause auch die Bezeichnung „Amtshaus“ wurde. In Nieder-Schönhausen wurde ein besonderes Amt, „das Justiz- und Oeconomie-Amt“ errichtet, welches Pankow in allen Guts- und Verwaltungssachen, Grundsachen und Steuersachen unterstellt wurde. Die Bewirtschaftung der Gutsäcker wurde offenbar bald eingestellt; die Hufen wurden den Kossätenhöfen Peter Krafft, Puhlmann und Liedemit zugelegt und diese dadurch zu Bauernhöfen erhoben. Nach dem Revisionsbericht von 1696 hatte Pankow 12 Bauernhöfe und 15 Kossätenhöfe und nach dem Revisionsbericht von 1768 nur 10 Kossätenhöfe und 15 Bauernhöfe.
Die Aufhebung der Oekonomie auf dem Gutshof hatte zur Folge, daß die Bauern die wöchentlichen gewohnten Hand- und Spanndienste in der Landwirtschaft nicht mehr in natura leisten brauchten. Die sparsamen Hohenzollern erließen ihnen diese Verpflichtung indessen nicht ohne weiteres, sondern zogen hinfort von jedem der 12 Bauern pro Jahr 10 Taler und von den 3 Kossäten je 5 Taler Dienstgeld[2] ein, jedoch wurde ihnen für den Ausfall an Verpflegung an den Arbeitstagen ein Deputat von 3 Scheffel Roggen, 2 Scheffel Gerste sowie einige Klafter Holz aus der königlichen Heide zugesprochen. Während den früheren Gutsherrn nur 7 Bauern zum Dienst verpflichtet waren, waren dem Kurfürsten als Lehnsherrn alle Bauern dienstpflichtig, denn dem Markgrafen stand, wie wir bei der Verteilung von 1370 sahen, der Hand- und Spanndienst (servitium curruum) an sich in natura zu von allen Bauern, aber nicht von allen Kossäten, da diese über Gespanne nicht verfügten; von den letzteren mußten nur die drei dem Gut zugehörigen Kossäten den Dienst wirklich leisten, während die obigen fünf vom Dienst in nature befreit waren, dafür aber jeder 6 Taler zahlen mußte. Auch der Schulze bezahlte Dienstgeld, und zwar 7 Taler. So bezog der Kurfürst an Dienstgeld 192 Taler. Damit waren sie aber nicht aller Dienste entledigt. Die Bauern hatten von altersher wegen Mangel an Wiesen und Weiden die Hütungsgerechtigkeit in der Jungfernheide für 130 Kühe und 500 Schafe. Dafür mußten sie Frondienste leisten, jährlich 39 Morgen pflügen, 18 Morgen eggen und eine Fuhre guter Kienäpfel zur Pflanzung anfahren. Dieser Frondienst blieb bestehen, ebenso die Holzfuhren für das Schloß Schönhausen und die Orangerie in Charlottenburg, welche ihnen jedoch mit 5 Groschen pro Fuhre bezahlt wurden.[3]
Zum Gut gehörte eine bedeutende Schäferei, welche am Westende des Dorfes lag (heute Breite Str. 22). Dieser stand allein und nicht den Bauern die Hütung auf der Feldmark und das Schafhütungsrecht in der Jungfernheide mit 400 Schafen zu. Friedrich I. behielt zwar das Eigentumsrecht, gab aber 1713 die Schäferei mit den Rechten sowie die zugehörige Wiese von 44 Morgen bei Pinnow an der Havel den Bauern in Zeitpacht. Dadurch erhielten die Bauern das Hüterecht auf ihrer Feldmark. Sie verpflichteten sich zu einer jährlichen Pacht von 133 Talern und zu einer jährlichen Anfuhr von 50 Fuhren Schafdung für den Schloßpark.[4] Bis 1689 gehörte zur Schäferei noch ein Bauernhof mit 2½ Hufen und ein Kossätenhof; die Höfe hatte von Grumbkow schon abgetrennt.
Das Schulzenamt im Ort wurde seit 1691 einem Bauern übertragen, welcher die Vermittlung mit dem Amte in Schönhausen übernahm. Der erste Schulze war Christoph Müller.
Die Könige ließen sich die Verschönerung ihrer Besitzung in Schönhausen sehr angelegen sein. Das Gutshaus erhielt durch den Baumeister Eosander von Göthe 2 Pavillons, der Garten der Meierei wurde erweitert, durch neue Anlagen verschönert und allmählich der Schloßpark geschaffen. Friedrich Wilhelm I. setzte die Arbeiten fort und Friedrich II. und seine Gattin vollendeten sie. Der Garten der Meierei von Schönhausen war ursprünglich wohl nur wenige Morgen groß. Friedrich I. kaufte von den Gemeinden Pankow und Schönhausen die angrenzenden Ländereien, auch den „großen“ und den „kleinen Eichwald“ südlich der Panke. Die Entschädigung bestand in Ackerstücken vom Gutsacker; so erhielten die Bauern von Schönhausen damals die elf Ritterhufen in Erbpacht, beide Gemeinden aber außerdemWiesen bei Spandau, welche den Bauern sehr willkommen waren, da die eigene Feldmark nicht genügend Wiesen hatte. Die Gemeinde Pankow behielt aber die Hütungsgerechtigkeit in dem Eichholz, welche erst 1831 mit 160 Talern abgelöst wurde.[5] Auch die Pfarre und Kirche von Pankow, welche am gemeinsamen Acker beteiligt waren, erhielten damals ihre Havelwiesen. Die Wiese der Pfarre, ein halber Morgen groß, wurde später (1879) veräußert, die Kirche hat ihre kleine Wiese, 20 Ruten groß, noch heute in Besitz, sie wird schon im Einkommennachweis der Kirche 1716 als „ein Schwad Gras, gibt 2 Groschen“ aufgeführt.
Folge 18
Die Zufahrt zum Schloß Schönhausen war umständlich. Die eigentliche Landstraße von Berlin war die Schönhauser Allee, welche aber in den Mühlenweg einbog und in der jetzigen alten Schönhauser Straße und weiter in der Lindenstraße ihre Fortsetzung bis Schönhausen hatte. Die heutige Berliner Straße von der Mühlenstraße bis zum Dorf war damals ein sandiger Ackerweg, welcher vor dem Dorf in einen Weg mündete, welcher links und rechts hinter den Gärten entlangführte. Er war der Feldweg zu den südlichen beiden großen Feldern der Feldmark, ohne Schatten, schmal und ausgefahren. Friedrich III. ließ den Berliner Weg mit Linden bepflanzen und verwandelte den sandigen Feldweg in eine breitere mit Linden eingefaßte Zufahrt zu seinem Gut. Ueber den Gutshof wurde ein fahrweg zur Kirche geschaffen, welcher über den Bauernhof des Martin Grunow hinweg bis zum Schloß in Schönhausen weitergeführt wurde. Aber dieser Weg, heute die Berliner und Schloßstraße, von der Mühlenstraße bis zum Schloß sollte keine öffentliche Straße sein. Nur die Wagen des Königs durften ihn befahren. Darum wurden an der Mühlenstraße, an der heutigen Apotheke, am Bauernhof Grunow und am Schloß Sperrgatter und Schlagbäume angebracht. Wieviel Aerger und Schreiberei haben diese Schlagbäume dem König, welcher von jeder Angelegenheit der Güter Kenntnis nahm, verursacht. Ein großes Aktenstück[1] handelt davon. Den bauern von Pankow, Schönhausen, Blankenfelde und Rosenthal, welche alle ihre Produkte, besonders der Milchwirtschaft nach Berlin fuhren, lag dieser Weg ja viel bequemer als der Mühlenweg. Bald war der Weg zerfahren, bald der Schlagbaum zerbrochen, bald muß der König die Klage hören, daß die mit der Bewachung Beauftragten jedem für ein Ei oder ein Weißbrot die Durchfahrt öffnen. Auch die Warnungstafeln, daß jeder Ertappte „mit vier Tagen Arbeit in der Forst“ bestraft würde, half wenig. Nur den Pankowern wurde der Weg freigegeben, wenn sie zum Feld oder zur Mühle fuhren, dem Pfarrer Ideler zur Kirchfahrt aber mit der Verwarnung „vor Mißbrauch“; dem Nachfolger Stockfisch wird erlaubt, sich auf seine Kosten einen Schlüssel zum Schlagbaum machen zu lassen, aber nur für seine Person. Noch 1795 wurden die Gatter und Schlagbäume erneuert[2] und haben bis in das neunzehnte Jahrhundert hinein bestanden.
[1] A. M.
[2] St. G. K., LXVIII. d. Nr. 3.
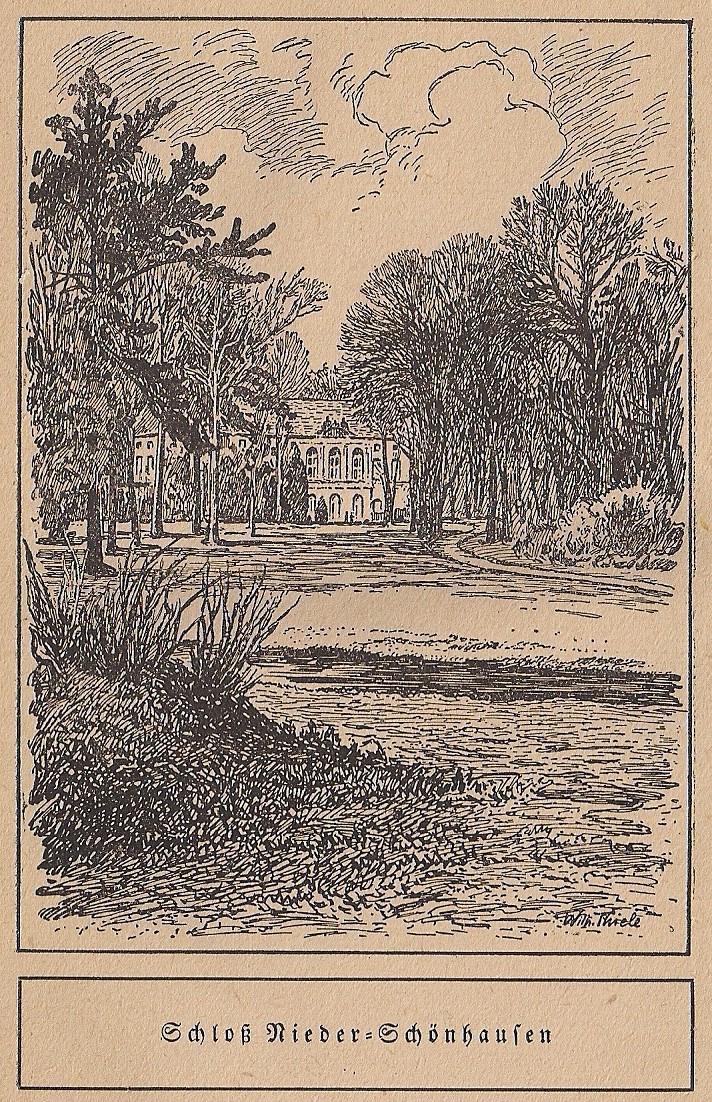
1740 schenkte Friedrich der Große das Schloß zu Schönhausenmit allen Rechten und Diensten der Königin zum Eigentum und zur selbständigen Verwaltung auf Lebenszeit. Sie verlangte nun, dass die Bauern von Pankow wöchentlich an einem Tag, die Kossäten an zwei Tagen zur Kultivierung des Parks wie in alten Zeiten Handdienste tun sollten, obwohl dieselben seit 30 jahren in natura nicht mehr Dienste leisteten, sondern das Dienstgeld bezahlten. Der König befahl die Dienste kurzerhand unter Beibehaltung der Dienstgeldzahlung, und es bedurfte langer Unterhandlungen mit den rechtlosen Bauern, bis der König das Dienstgeld der Kasse der Königin überwies zur Annahme der nötigen Arbeitskräfte. Die Spanndienste zum Garten und Schloß mußten sie weiter leisten und erhielten bei eigener Beköstigung 2 Gr. 6 Pfennig für den Tag und das Gespann.[1]
Wir sehen auch aus diesem kleinen Zug, wie drückend die Abhängigkeit und Untertänigkeit auf dem Bauernstand lag. Friedrich der Große empfand es wohl und befahl für seine Lande, daß die erbuntertänigen Bauern „nicht mehr als drei oder vier Tage (!) in der Woche zu Hofe dienen dürften, auch daß sie nicht mehr mit dem Stock geschlagen wurden“. In einem selbstverfaßten Protokoll Friedrichs heißt es: „Die Richter müssen nur wissen, daß der geringste Bauer ebensogut ein Mensch ist wie seine Majestät, und daß ihm alle Justiz widerfahren muß.“ Der Kurfürst Friedrich III. hatte die Besitzungen in Pankow noch erweitert. Er erwarb gegenüber dem Gutshof auf der Nordseite der Dorfstraße zwei Kossätenhöfe, ließ die Gebäude niederreißen und für die Kavaliere, welche zum Schloß Schönhausen befohlen wurden, ein Kavalierhaus errichten. Dieses Haus wurde später durch einen Lindenweg (die heutige Kavalierstraße) mit dem Eichholz und dem Schloßplatz verbunden.
König Friedrich II. hatte für die Besitzungen in Pankow nicht das interesse, welches seine Vorfahren Friedrich I. und Friedrich Wilhelm I. bekundet hatten. Die großen Aufgaben Preußens nahmen ihn in Anspruch. als daher 1751 die Witwe des Leutnants Falk[2] die Bitte an den König richtete, ihr das Amtshaus mit den Gärten gegen einen Jahreszins von 30 Talern zum Eigentum zu geben, schenkte ihr Friedrich II. das Gut, zumal ihr Ehemann an den bei Hohenfriedberg empfangenen Wunden gestorben war. Im Amtshaus hatte der Amtmann Schmidt, welcher seit dreißig Jahren in demselben wohnte, ohne besondere Genehmigung einen Ausschank von Bier und Wein für Berliner Gäste betrieben. Diesen Ausschank wollte die Falk fortsetzen und dadurch sich und ihre Familie ernähren. Der König mochte wohl auch dadurch zur Schenkung bestimmt worden sein, daß das Gut zu einem dauernden Sitz durch seine Lage nicht geeignet war, denn die nördliche Dorfseite trennte es vom Schloßpark, über den Hof ging eine Durchfahrt, und eine Vergrößerung war ohne Einziehung von Dorfstellen nicht zu denken. Dazu machte das Schloß mit dem herrlichen Park das Gut entbehrlich. Aber noch ein anderer Gedanke leitete ihn bei dieser Schenkung. Des Königs Interesse war, wie bekannt, zur Hebung der Landeseinnahmen auch auf die Seidenfabrikation gelenkt. In vielen Dörfern entstanden deshalb damals Anpflanzungen von Maulbeerbäumen zur Zucht von Seidenraupen. Auch in Pankow sollte nach des Königs Willen eine Plantage erstehen; es wurde die Verpflichtung, 120 Bäume im Abstand von 18 Fuß in dem Gutsgarten der sogenannten „Insel“ anzupflanzen, den Besitzern des Gutes auferlegt.[3] Durch den schnellen, häufigen Besitzwechsel wie auch durch die Folgen des Siebenjährigen Krieges ist sie Verwirklichung dieser Verpflichtung unterblieben und 1797 durch Verhandlung mit dem Besitzer Blanc beseitigt worden.[4] Indem der König alle Rechte am Ort, an den Höfen, an der Dorfaue und das Patronat der Kirche der königlichen Familie vorbehielt, veräußerte er das Gut als Erbzinsgut.
[1] St. G. K. LXXIII. Sekt. d. Nr. 10
[2] G. K., Sekt c, Tit. LXXIII, Nr. 6
[3] G. K., Tit. LXXIII, Sekt. c, Nr. 6
[4] G. K., Tit. LXXIII, Sekt. c, Nr. 6
Folge 19
Da sich die Absicht des Ausschankes, wie wir später noch sehen werden, nicht verwirklichen ließ, trat Frau Leutnant Falk 1753 ihr Besitzrecht an Frau Geheimrat Müller geborene de Bourdaire ab. Der Erbzins wurde auf 40 Taler erhöht. Nach dem Berichte des Generaldirektoriums der Kurmark bestand der Besitz aus folgenden Stücken: „Das Amtshaus, das danebenliegende sogenannte Leinweberhaus, die beiden Gärten zu beiden Seiten des Hauses, ein altes Familienhaus im Garten, die gegen dem Amtshause über gelegene sogenannte Insel, auch zwei Stände in dortiger Kirche.“ Die Besitzerin übernimmt die Verpflichtung, „Gebäude und Gehegen auf eigene Kosten zu unterhalten wie auch den nahe am Amtshause befindlichen Schlagbaum in guten Zustand zu setzen und zu unterhalten, auch ihn durch ihre Leute in Aufsicht halten, verschließen und öffnen zu lassen, sie verpflichtet sich, die Insel mit Plantagenmäßigen Bäumen à 18 Fuß von einander binnen zwei Jahren zu besetzen und begibt sich endlich alles Wein und Bierschanks“ (30. Juli 1753.[1]) in demselben Aktenstück lesen wir: „Die Insel ist von dem Hauptgrundstück, das Amtshaus genannt, durch den Weg von Berlin nach Pankow getrennt (das ist die Berliner Straße, die von Friedrich III. geschaffenen Durchfahrt) und liegt auf der linken Seite des Weges unweit dem Bauerngut des Zwarg“.
Das sind die ersten genaueren Angaben über die Lage des alten historischen Lehnschulzengutes, welches in alter Zeit mit so hohen Rechten ausgestattet war und dessen Besitzer wir seit 1355 verfolgt haben. Durch mündliche Ueberlieferung wissen wir genau, daß das alte Amtshaus an der Ecke Berliner und Schloßstraße stand, wo heute die Apotheke sich befindet, nur daß der Westgiebel fast bis auf die Mitte der Berliner Straße reichte. Wir kennen ferner den alten bauernhof Zwarg; er lag an der anderen Ecke dieser Straße, auf dem Gebiet des Gutshofes. Die Hohenzollern hatten ihn bei Aufhebung der Gutslandwirtschaft gebildet und mit Ackerteilen des Gutes ausgestattet. Wir kennen die späteren Besitzer des Gutes und seiner Teile, wie wir in den weiteren Zeilen sehen werden. Darum können wir die Grenzen des Gutshofes nun genau bestimmen. Der alte Lehnschulzenhof schloß sich östlich direkt an das Pfarrgehöft an, umfaßte die Gärten zwischen der Breiten Straße und Schulstraße, ferner die Berliner Straße und das Apothekengrundstück einschließlich des parkartigen Gartens längs der Front der Berliner Straße. Für dieses Gut befanden sich nach dem Aktennachweis in der Kirche besondere Patronatssitze.
Frau Geheimrat Müller sollte in ihrem Besitz schwere Zeiten durchleben. Der Siebenjährige Krieg brach aus, welcher auch unserem Ort schwere Verwüstung und Plünderung brachte.
Während Friedrich der Große im Verlauf dieses Krieges mit seinen Truppen in Sachsen weilte, fielen 1760üsterreichische und russische Truppen in die Mark ein, verwüsteten sie und besetzten Berlin. Die Kunde vom Siege bei Torgau verhinderte, daß Soltikoff mit den Russen im brandenburgischen überwinterte. In rascher Flucht räumte der Feind die Mark, aber wie fürchterlich hatte er hier gehaust. Das Schloß Schönhausen war geplündert, der Park verwüstet und die Königin nach Magdeburg geflohen. Wie mögen die Horden in Pankow gewütet haben. Im alten Kirchenbuch finden wir 14. April 1760 die Bemerkung des Pfarrers Stockfisch: „Da die Russen hier anfingen herumzustreichen, und alles hier verwüsteten und verheerten, auch ein erbärmlicher Zustand anzutreffen war, so ist bei dem Wüten und Toben niedergehauen der alte Gensicke.“ Wieviel Not und Verlust, Gewalttat und Grausamkeit umschließen die wenigen Worte. Vier Jahre nach den Ueberfall bat Pfarrer Corthym [2]) um die Wiederherstellung des von den Russen abgebrannten Geheges um den Pfarrgarten. Pfarrer Stockfisch starb tiefgebeugt noch in demselben Jahre und nam den schmerzvollen Anblick seiner verwüsteten Parochie mit in das Grab. Schwere Zeiten hatte er in pankow durchlebt. Aus dem letzten Jahre seines Lebens haben wir von ihm noch ein Bittgesuch, in dem er schreibt: „Als ich vor 29 Jahren das hiesige Pfarrhaus bezogen hatte, fand ich solches für mich sehr klein, mit zwei (!) Stuben. Da mir aber nach Verfließung mehrerer Jahre meine Familie zuwuchs und ich einen tüchtigen Lehrer für die Kinder anzuschaffen hatte, sah ich micgh genötigt, noch etwas Gelas anzuschaffen und dieserhalb aus meinen eigenen Mitteln eine besondere Stube anzubauen“, und nun bittet er um 30 Taler Zuschuß. [3]
Wieder waren die Saaten zertreten, Ställe und Scheunen geplündert, die Häuser ausgeraubt, Pferde und Vieh genommen und alle Vorräte erschöpft. Wir haben außer jener kurzen Botschaft des Pfarrers Stockfisch noch einen langen besonderen Bericht. Frau Geheimrat Müller hatte in ihremKaufbrief verbrieft erhalten, daß ihr altes Amtshaus frei von Einquartierungen sein sollte, und gerade auf ihrem Hof hatte sich der Feind so fürchterlich niedergelassen, daß sie in tiefster Not ihren König um Erlaß des jahreszins bitten muß. Ihrer Petition an den König liegt ein Bericht der Verwüstung bei.[4]) Beides läßt er uns erkennen, den Reichtum, welcher in den vornehmen Landhäusern unseres Ortes herrschte, und die Unmenschlichkeit der Russen, welche alles mitnahmen, das Vieh im Stall, das Geld im Kasten, das Ornament an der Wand oder das Porzellan im Schrank; was nicht zu verwerten war, wurde wenigstens vernichtet.
Da sich die Absicht des Ausschankes, wie wir später noch sehen werden, nicht verwirklichen ließ, trat Frau Leutnant Falk 1753 ihr Besitzrecht an Frau Geheimrat Müller geborene de Bourdaire ab. Der Erbzins wurde auf 40 Taler erhöht. Nach dem Berichte des Generaldirektoriums der Kurmark bestand der Besitz aus folgenden Stücken: „Das Amtshaus, das danebenliegende sogenannte Leinweberhaus, die beiden Gärten zu beiden Seiten des Hauses, ein altes Familienhaus im Garten, die gegen dem Amtshause über gelegene sogenannte Insel, auch zwei Stände in dortiger Kirche.“ Die Besitzerin übernimmt die Verpflichtung, „Gebäude und Gehegen auf eigene Kosten zu unterhalten wie auch den nahe am Amtshause befindlichen Schlagbaum in guten Zustand zu setzen und zu unterhalten, auch ihn durch ihre Leute in Aufsicht halten, verschließen und öffnen zu lassen, sie verpflichtet sich, die Insel mit Plantagenmäßigen Bäumen à 18 Fuß von einander binnen zwei Jahren zu besetzen und begibt sich endlich alles Wein und Bierschanks“ (30. Juli 1753.[1]) in demselben Aktenstück lesen wir: „Die Insel ist von dem Hauptgrundstück, das Amtshaus genannt, durch den Weg von Berlin nach Pankow getrennt (das ist die Berliner Straße, die von Friedrich III. geschaffenen Durchfahrt) und liegt auf der linken Seite des Weges unweit dem Bauerngut des Zwarg“.
Das sind die ersten genaueren Angaben über die Lage des alten historischen Lehnschulzengutes, welches in alter Zeit mit so hohen Rechten ausgestattet war und dessen Besitzer wir seit 1355 verfolgt haben. Durch mündliche Ueberlieferung wissen wir genau, daß das alte Amtshaus an der Ecke Berliner und Schloßstraße stand, wo heute die Apotheke sich befindet, nur daß der Westgiebel fast bis auf die Mitte der Berliner Straße reichte. Wir kennen ferner den alten bauernhof Zwarg; er lag an der anderen Ecke dieser Straße, auf dem Gebiet des Gutshofes. Die Hohenzollern hatten ihn bei Aufhebung der Gutslandwirtschaft gebildet und mit Ackerteilen des Gutes ausgestattet. Wir kennen die späteren Besitzer des Gutes und seiner Teile, wie wir in den weiteren Zeilen sehen werden. Darum können wir die Grenzen des Gutshofes nun genau bestimmen. Der alte Lehnschulzenhof schloß sich östlich direkt an das Pfarrgehöft an, umfaßte die Gärten zwischen der Breiten Straße und Schulstraße, ferner die Berliner Straße und das Apothekengrundstück einschließlich des parkartigen Gartens längs der Front der Berliner Straße. Für dieses Gut befanden sich nach dem Aktennachweis in der Kirche besondere Patronatssitze.
Frau Geheimrat Müller sollte in ihrem Besitz schwere Zeiten durchleben. Der Siebenjährige Krieg brach aus, welcher auch unserem Ort schwere Verwüstung und Plünderung brachte.
Während Friedrich der Große im Verlauf dieses Krieges mit seinen Truppen in Sachsen weilte, fielen 1760üsterreichische und russische Truppen in die Mark ein, verwüsteten sie und besetzten Berlin. Die Kunde vom Siege bei Torgau verhinderte, daß Soltikoff mit den Russen im brandenburgischen überwinterte. In rascher Flucht räumte der Feind die Mark, aber wie fürchterlich hatte er hier gehaust. Das Schloß Schönhausen war geplündert, der Park verwüstet und die Königin nach Magdeburg geflohen. Wie mögen die Horden in Pankow gewütet haben. Im alten Kirchenbuch finden wir 14. April 1760 die Bemerkung des Pfarrers Stockfisch: „Da die Russen hier anfingen herumzustreichen, und alles hier verwüsteten und verheerten, auch ein erbärmlicher Zustand anzutreffen war, so ist bei dem Wüten und Toben niedergehauen der alte Gensicke.“ Wieviel Not und Verlust, Gewalttat und Grausamkeit umschließen die wenigen Worte. Vier Jahre nach den Ueberfall bat Pfarrer Corthym [2]) um die Wiederherstellung des von den Russen abgebrannten Geheges um den Pfarrgarten. Pfarrer Stockfisch starb tiefgebeugt noch in demselben Jahre und nam den schmerzvollen Anblick seiner verwüsteten Parochie mit in das Grab. Schwere Zeiten hatte er in pankow durchlebt. Aus dem letzten Jahre seines Lebens haben wir von ihm noch ein Bittgesuch, in dem er schreibt: „Als ich vor 29 Jahren das hiesige Pfarrhaus bezogen hatte, fand ich solches für mich sehr klein, mit zwei (!) Stuben. Da mir aber nach Verfließung mehrerer Jahre meine Familie zuwuchs und ich einen tüchtigen Lehrer für die Kinder anzuschaffen hatte, sah ich micgh genötigt, noch etwas Gelas anzuschaffen und dieserhalb aus meinen eigenen Mitteln eine besondere Stube anzubauen“, und nun bittet er um 30 Taler Zuschuß. [3]
Wieder waren die Saaten zertreten, Ställe und Scheunen geplündert, die Häuser ausgeraubt, Pferde und Vieh genommen und alle Vorräte erschöpft. Wir haben außer jener kurzen Botschaft des Pfarrers Stockfisch noch einen langen besonderen Bericht. Frau Geheimrat Müller hatte in ihremKaufbrief verbrieft erhalten, daß ihr altes Amtshaus frei von Einquartierungen sein sollte, und gerade auf ihrem Hof hatte sich der Feind so fürchterlich niedergelassen, daß sie in tiefster Not ihren König um Erlaß des jahreszins bitten muß. Ihrer Petition an den König liegt ein Bericht der Verwüstung bei.[4]) Beides läßt er uns erkennen, den Reichtum, welcher in den vornehmen Landhäusern unseres Ortes herrschte, und die Unmenschlichkeit der Russen, welche alles mitnahmen, das Vieh im Stall, das Geld im Kasten, das Ornament an der Wand oder das Porzellan im Schrank; was nicht zu verwerten war, wurde wenigstens vernichtet.
[1] G. K., Tit. LXXIII, Sekt. C, Nr. 6
[2] Amt Mühlenhof
[3] Amt Mühlenhof.
[4] G. K., Tit. LXXIII, Sekt. C, Nr. 10S
[1] G. K., Tit. LXXIII, Sekt. C, Nr. 6
[2] Amt Mühlenhof
[3] Amt Mühlenhof.
[4] G. K., Tit. LXXIII, Sekt. C, Nr. 10S
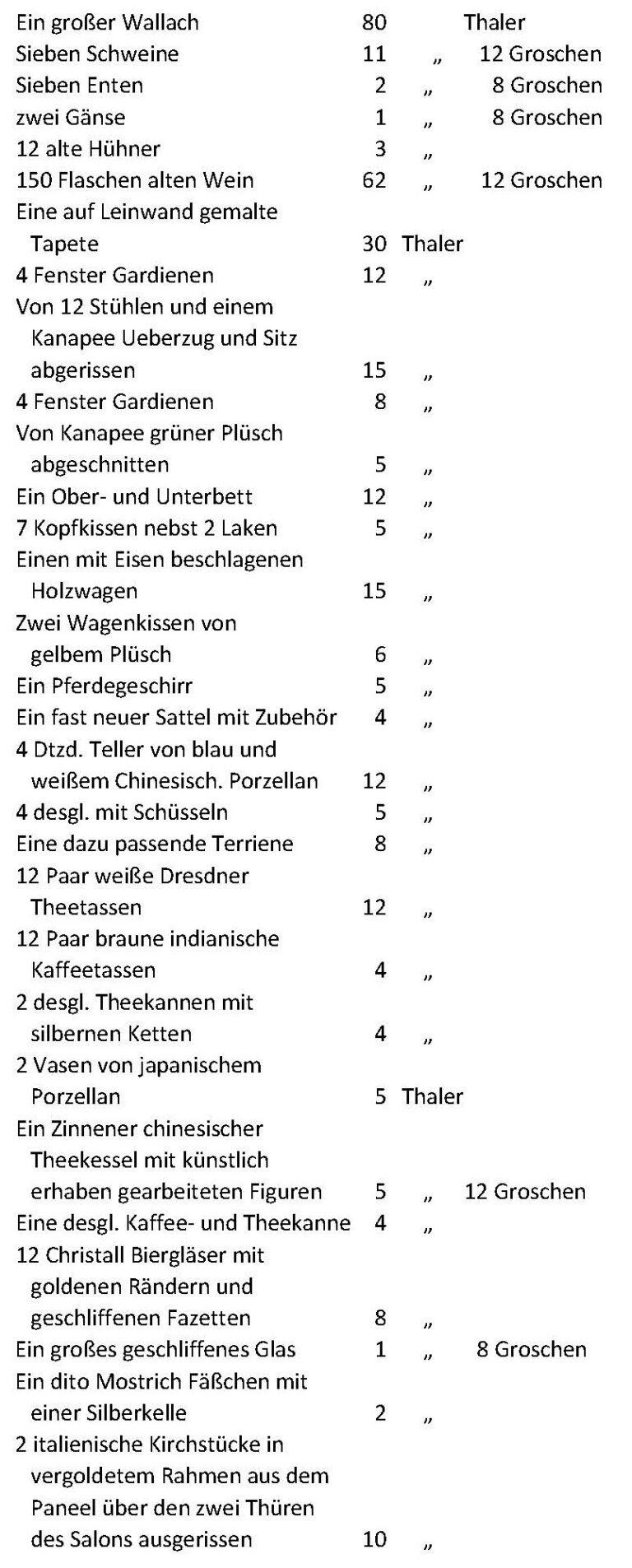
Folge 20
Frau Geheimrat Müller war nicht reich. Sie hatte diese Dinge teilweise von ihrem Bruder geerbt, welcher viele Länder durchreist hatte. Sie geriet durch die Not der Zeit in Schulden und mußte 1763 ihren Besitz an „den Schutzjuden und Münz-Entrepreneur Daniel Itzig“ zu Berlin für 2700 Taler verkaufen.[1] Die Glanzzeit des stolzen Gutes war dahin. Die Häuser wurden nicht mehr im rechten Stand gehalten und die Gärten nicht mehr gepflegt, schnell ging es von Hand zu Hand.1764 übernahm es der Bankier Schweiger für 5500 Taler und drei Monate später der Hofbildhauer Carl Philipp Glome für 1100 Taler. Von diesem erwarb es 1775 die Gräfin Matuschka geborene Encke für 1650 Taler und noch in demselben Jahre die Stiftsrätin von Labes für 570 Taler. Inzwischen war es zu einem Prozeß gekommen, wegen der unterlassenen Anlage der maulbeerplantagen und wegen des Laudemiums. Das Gut war ein Erbzinsgut. Es mußte daher bei jedem Verkauf des Gutes wie auch jedes der einst zu ihm gehörigen Höfe der fünfzigste Teil des Kaufwertes an die Staatskasse gezahlt werden. Die Verkäufe von der Falck bis zur von Labes waren aber alle nur vor dem Notar und nicht vor dem Kammergericht vollzogen worden. Die hinterzogene Abführung des jedesmaligen Laudemiums wurde von der Stiftsrätin gefordert. Noch war der Prozeß nicht entschieden, da schenkte[2] diese das Gut dem königlichen Joachimstalschen Gymnasium mit der Bestimmung, daß aus dem Ertrage des Gutes oder den Zinsen des Verkaufswertes märkische Studierende ein Stipendium erhalten sollten. Das Gymnasium war eine Hohenzollernstiftung und der Zweck der Stiftung ein Wohltätiger; das gab dem Prozeß die günstige Wendung, daß alle Nachzahlungen erlassen wurden. Das Gymnasium verkaufte[3] das Gut 1796 für 3000 Taler an frau von Anniéres. Sie war die letzte Besitzerin, welche beide durch den Berliner Weg getrennten Teile zusammen besaß. Indem sie 1797 „die Insel“ den Kaufmann Blanc[4] verkaufte, wurde für immer die Trennung beider Teile vollzogen. Bei dem Verkauf durch das Gymnasium findet sich die Bestimmung[5] „jedoch exklusive des Stück Lanes von 36 Fuß lang und und 14 Fuß tief, so der Kirche zu Pankow als ihr Eigentum hat abtreten werden müssen“, das muß dasselbe Stück Land sein, welches im Einkommennachweis der Pfarre 1815 erwähnt wird:
[1] St. G. K., Tit. LXXIII, Sekt. c, Nr. 6.
[2] St. G. K., Tit. LXXIII, Sekt. c, Nr. 6
[3] A. M. und wie 73.
[4] St. G. K., Tit. LXXIII, Sekt. c, Nr. 6
[5] A. M.
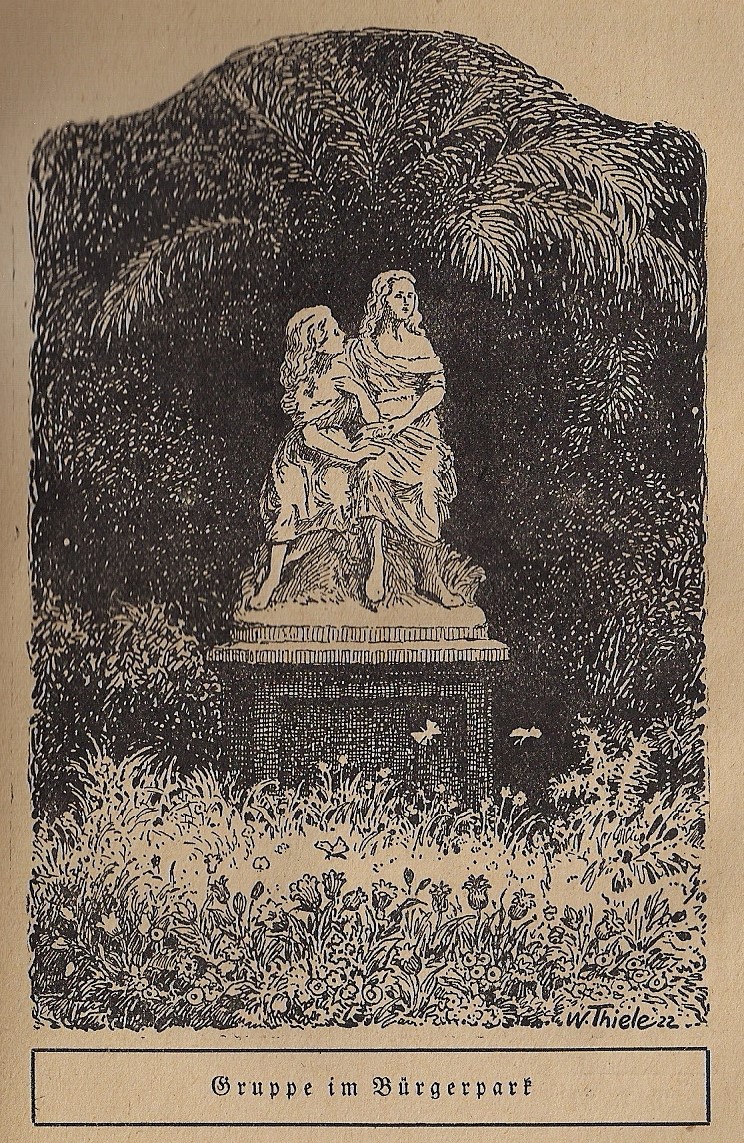
„Für ein Stück Pfarrland, darauf Kaufmann Blanc ein Haus gebaut, jährlich 20 Taler Kunon“. Das Pfarrgehöft war damals größer, als es heute ist, und zwar hat zu demselben noch das Vorderland an der Dorfstraße gehört, welches zwischen dem Pfarrhof und dem Bauer Ohm lag (Breite Str. 39). Wir wissen auch von einem Erbpachtkontrakt, welchen 1790 der Pfarrer für ein vom Pfarrgehöft abgezweigtes Stück Land schloß, von dem er 20 Taler Erbpacht bezog, und für die Pfarre das Laudemium von 2 % bei jedem Verkauf, Schenkung oder Vermächtnis und das Vorkaufsrecht sicherte. Unsere Annahme bestätigt auch der Antrag des Kaufmanns Brunzlow, des späteren Besitzers der Insel, welcher 1835 den Erbpachtkontrakt durch Ablösung der Erbpacht auflösen und dieses Trennstück, welches die Insel von der Dorfstraße abschloß, definitiv erwerben will, worauf der Pfarrer allerdings nicht einging.[1] In der Annahme, daß es von Interesse ist, die Reihe der Besitzer des alten Gutes von der ältesten Zeit bis in die Neuzeit hinein zu kennen, sind die vorstehenden genaueren Daten hier wiedergegeben worden.
Damit sind wir aber vorausgeeilt, und wir gehen noch einmal einige Jahrzehnte zurück. Den Gärtnern David Illarie, Bartel Lafoße, Jacob Siergen, Henry Roé, französischen Flüchtlingen, waren 1695 Kossätenhöfe übergeben worden auf einige Jahre. Wir hören in diesem Jahrhundert wieder von ihnen. Nachdem sie sich in deutsche Verhältnisse eingewöhnt hatten, erwarben sie festen Besitz in Pankow. Heinrich Roé kaufte den Kossätenhof neben dem Bauer Christoph Müller (heute Hildebrand) erb- und eigentümlich für 125 Taler, der Gärtner Jacob Sierge den Kössätenhof direkt neben „dem Kgl. Hofstaatshaus“ (Amtshaus) für dieselbe Summe (heute Ehestedt, Hartmann), ebenso Henry Roé den von ihm gemieteten Hof und Franz Rouge seinen Hof 1706.[2] Die Abgaben betrugen auf jedem Hof an Hofdienst 6 Taler, Geldzins 16 Groschen, 8 Hühner = 16 Groschen, 6 Eier = 1 Groschen, Fleischzehend = 15 Groschen, Roggengeld für den Garten 1 Taler, Wiesenheugeld 1 Taler, zusammen je 10 Taler.[3]
Auch der Küster George Frehden erwarb 1706 einen verfallenen Kossätenhof für sich erb- und eigentümlich für 40 Taler. Der Kossät Liedemit heiratete später die Küsterwitwe und übernahm den Kossätenhof.[4] Der Franzose Henry Roé pachtete 1713 auf sechs Jahre zu seinem Kossätenhof noch den bauernhof mit 2½ Hufen, auf welchem die Schäferei sich befand. Diese Gutsschäferei pachtete von 1713 an die Gemeinde für anfangs 88 Taler, später 113 Taler, auf Zeitpacht (Breite Straße 22).
Eine Anzahl Besitzveränderungen dieses Jahrhunderts sind uns noch nekannt, welche zum Teil interessant sind und beweisen, wie der König Friedrich II. manchen Verkauf ablehnte oder durch Bestimmungen änderte, wenn das Wohl des Ortes in Frage stand. Grundsätzlich belehnte der König bei einem Verkauf nur noch mit e r b l i c h e m Besitz. Die Bauernhöfe und die Kossätenhöfe waren mit Ausnahme der freien Höfe, denen es aber keinen in Pankow gab, sogenannte „Laßgüter“, sie waren dem Gutsherrn erbuntertänig und in ihrem Besitz eigentlich nicht erblich; der Grund und Boden gehörte dem Herrn, nur was darauf von ihnen selbst gebaut war oder was sie an Stücken aller Art erworben hatten, war ihr Eigentum. Daraus erklärt sich auch der geringe Kaufpreis der Höfe. Im kaufkontrakt des Geheimen Rats Grumbkow 1680 ist der Preis eines Kossätenhofes noch mit 44 Talern [5] angegeben. Die Höfe gingen allerdings stets auf den Sohn über, denn es lag dem Herrn gar nicht daran, die Familie zu wechseln. In mancher Verhandlung bezeichnen sich die Bauen unseres Ortes direkt als „Laßbauern“. Waren die Rechte der Stellenbesitzer darum geringer, so waren die Pflichten des Herrn andererseits höher. Neubau oder Reparatur der Gebäude lag dem Herrn ob. Durch die Belehnung als erblichen Besitz erhöhte sich der Kaufpreis bedeutend, und damit auch die Lehnsgebühr, dagegen aber gab der Herr von da an zu Reparaturen nur noch das Holz.
Die Kriegsräte Kornemann, Tournier und Caps wurden erblich belehnt. 1761 erwarb der Kriegsrat Kornemann den Kossätenhof des Martin Lorentz, bisher nicht erblich, von nun an erblich, für 200 Taler. Der König genehmigte den Verkauf aber nur unter der Bestimmung, daß der alte Martin Lorentz mit seinen 200 Talern das Dorf nicht verlassen darf, sondern sich als Büdner anbauen muß. [6] Diese Unfreiheit im Wohnsitz war auch eins von den harten Stücken der Untertänigkeit. Dem König lag daran, keine ländliche Familie zu verlieren.
1760 hatte der kriegsrat Tournier das Gehöft des Martin Frede zwischen Bauer Liedemit und KossätMartin Lorentz für 200 Taler gekauft. Der König bedachte, daß die Dorfgemeinschaft geschädigt würde, wenn die Kossätenfamilien alle verschwinden, und daß im Bedarfsfall es ab hand- und Spanndiensten fehlen könnte. Die Bauern wandten ihrerseits mit Beziehung auf ihre kleineren Pflichten ein, „wer soll den Stock weiter zum Nachbarn tragen“. Daher bestimmte der König, daß Tournier ein familienhaus für zwei Tagelöhner auf seinem Besitz erbauen solle. Kriegsrat Tournier starb über die Verhandlungen hin, und der nachfolger, Kriegsrat Cabs, mußte 1770 zwei Büdnerhäuser auf einer ihm beschafften Baustelle im Ort errichten.[7] Sie wurden an dem Westende der Dorfaue, direkt am Dorfteich, mitten in der breiten Dorfstraße erbaut.
Der König duldete ferner nicht, daß etwa ein Bauernhof in privaten Besitz überging ohne den zugehörigen Acker und Uebernahme aller Pflichten; der Landbesitz durfte vom Hof nicht getrennt werden. Der Seidenfabrikant Girard kaufte von Jacob Hanrion das frühere Hucksche Bauerngut mit allem Zubehör, 2½ Hufen Acker und Wiesenwuchs für 2000 Taler. Auf dem Hofe lasteten königliche Jagd- und Amtsfuhren, die sogenannten Königsreisen, der Fleischzehend und der Hofdienst. Girard leistete diese verpflichtungen in Geld. Da es ihm nur auf den schön gelegenen Hof ankam, so wollte er den ganzen Acker an die Kossäten Michael Jemke und Martin Freede vererbpachten mit der Verpflichtung, alle Abgaben des Hofes mitzuübernehmen. Der König erkannte, daß dadurch der Bauernhof für immer aufhörte und ebenso eine ländliche Familie mit ihren Verpflichtungen der Bauerngemeinschaft verloren ginge. Darum verbot er die Vererbpachtung und genehmigte nur die Verpachtung auf Zeit, alle lasten blieben auf dem Hof.[8]
Gern sah der König, wenn Handwerker einwanderten. Er begünstigte ihre Niederlassung. Die gemeinden gaben ihnen eine kleine Baustelle und das Bauholz, damit sie sich auf eigene Kosten Haus und Stall errichten konnten. Die Baustellen für diese Leute waren in Pankow sehr beschränkt, denn es kam doch nur die Dorfstraße in Betracht, da alle anderen Teile des Dorfes zur gemeinsamen Feldmark gehörten. Da nun an der Dorfstraße die Höfe lagen, so verwandte man auch die Mitte der Dorfaue zu Ansiedlungen. Von einer Ansiedlung wird uns aus dem Jahre 1751 berichtet. [9] Der Müllerknecht Vogel aus Sachsen erbaute sich ein Büdnerhaus neben dem Küstergehöft, wo schon der Windmüller sein Haus und Garten hatte. Neben der Küsterei ist also nicht ein Kossätenhof einst gewesen. Gegen diese Ansiedlung neben dem Küster und Müller legte die Krugbesitzerin Witte energisch Protest bei der Domänenkammer ein, welcher zu langen Verhandlungen führte und insofern für uns noch interessant ist, daß er uns die Entstehung der Häuser neben dem Küsterhaus aufdeckt und die Nachricht gibt, daß dort in älterer Zeit sich auch nach den Aussagen der Bauern jener Tage die Schmiede befunden hat. Letztere ging wohl 1680 ein, als von Grumbkow in Nieder-Schönhausen eine ständige Schmiede errichtete und dieser die Versorgung auch unseres Ortes überwies.[10]
[1] A. M.
[2] A. M.
[3] A. M.
[4] A. M.
[5] R. B. „Dörfer und Ländereien“
[6] St. G. K., Tit.LXXIII. Sekt. c., Nr. 9
[7] St. G. K., Tit.LXXIII. Sekt. c., Nr. 8
[8] St. G. K., Tit.LXXIII. Sekt. c., Nr. 6
[9] A. M.
[10] A. M.
Folge 21
Wie wir schon auf früheren Seiten sahen, war die Schaffung von Maulbeerplantagen und Seidenfabriken ein Lieblingsgedanke des Königs Friedrichs II. Der sparsame König war hierin selbst zu großen Opfern bereit. Die Plantage auf der „Insel“ war wenig geglückt; so wollte er an einer anderen Stelle unseres Ortes zu besserem Erfolge helfen. Staatsrat Kornemann hatte 1760 den Hof des Kossäten Lorentz erworben; der Hof lag auf der Nordseite der Dorfstraße am Westende neben dem Hirtenhaus (jetzt etwa Breite Str. 23 u. 24). Zu diesem Hof gehörten einige Morgen Wiesenland, welche hinter dem Hof lagen und an den Schönholzer Weg stießen. Auf diesem Wiesenland pflanzte Kornemann 500 Maulbeerbäume 1783 an und erhielt vom König durch das Amt Schönhausen 684 Taler Beihilfe, um ein Haus zur Seidenfabrikation zu errichten.[1]. An Fleiß und gutem Willen fehlte es nicht, und der Hofgärtner Rietner mußte jährlich über die Anlage und den Fortgang berichten. Auch dieses Unternehmen schlug fehl. Kornemann starb 1790, und die Besitzung ging in andere Hände über. Den Hof erwarb der Weinhändler Bernoully, nach ihm 1816 Müller, die Plantage aber Gärtner Rietner. Auch der König war gestorben und das Interesse an all diesen Anlagen erkaltet. Da die Plantage nicht gedieh, wurde die Anlage an den Kaufmann Quadt verkauft, welcher das Grundstück in anderer Weise nutzbar machte. Der vorsichtige König hatte aber die Verpflichtung zum Seidenbau grundbuchlich eintragen lassen, und so kam es, daß die Regierung nach langen Jahren 1848 über das Kornemannsche jetzt Quandtsche Seidenetablissement Bericht einforderte und vom Besitzer eine Ablösung der Verpflichtung mit 36 Taler einzog.[2]
Von der Not der ländlichen Familien zeugt, daß der Bauer Huck 1766 seinen Hof und Acker an den Kossäten Jacob Hanrion verkaufen muß, und daß ein halber Kossätenhof, dessen Abgaben nicht entrichtet wurden, an Donner, den Kammerdiener der Königin, überging.[3]
Wegen des zugehörigen Ackers und der schweren Lasten war der Verkauf der Bauerngüter an Privatbesitzer nicht möglich, so daß am Ende des Jahrhunderts noch 14 Bauernwirtschaften im Dorfe waren; dagegen waren die Kossätenhöfe bis auf einen einzigen zu Sommersitzen der Berliner geworden. Ihre Besitzer waren Bankiers, Großkaufleute und Männer der hohen Bureaukratie. Die Nähe des Schlosses und des Parkes, der herrliche Baumschmuck des Ortes, die ländliche Stille und die herrliche vom König gepflegte Lindenallee von den Toren Berlins bis zum Ort, das alles zog die Berliner zu unserem Dorfe.
Die vornehme Welt Berlins drängte sich damals geradezu um Landhäuser in Pankow. Kurfürst Friedrich III. hatte 1692 aus dem Gutshof zwei Bauernhöfe (Bauer Zwarg und Bauer Ohm) gebildet, wlche an der Dorfstraße zwischen der Durchfahrt (Berliner Straße) und der Pfarre lagen; da hinter den Höfen der Gutsgarten „die Insel“ lag, so wurde den Höfen ein Hausgarten an anderer Stelle des Ortes angewiesen. Der Garten des Hofes Zwarg lag auf der Südseite der Dorfstraße, nach Karten von 1812 und 1818 im Verein mit einem Bericht können wir die Lage genau bestimmen. Diesen Garten (heute Breite Str. 43a) erwarb der Hofjuwelier Jordan Friedel und schuf in ihm einen herrlichen Sommersitz.[4]
Der Kammerherr Berdy du Bernois erwarb von der Bäuerin Wurstmacher 1 Morgen am Schönholzer Weg und der Kriegsrat Jordan von ihr einen Teil ihrer Hofstelle.[5]
Schon seit Anfang des Jahrhunderts besaß von Stosch die beiden Kossätenhöfe, welche von Grumbkow 1689 von der Schäferei abgetrennt hatte. 1806 wurde wegen der Größe dieser Höfe ein Prozeß geführt, aus dessen Akten[6] wir die Lage dieser beiden Höfe sowie ihrer verschiedenen Besitzer bestimmen können. Der eine Hof war der heutige Amalienpark, dessen Besitzer von Stosch, von Ziegler, Hanrion, Platzmann, Baudouin waren, von dem ihn 1806 Geheimer Medizinalrat Hermbstaedt für 6500 Taler kaufte. Der andere Hof war die heutige Nervenheilanstalt des Dr. Scholinus; Besitzer waren in der Folge von Stosch, Ziegler, Hanrion, Kammerdiener Donner, Staatsrat Labaye, 1816 Bankier Lessing.
Nur ein Bauerngut, welches einst Bauer Huck besessen, war in den Besitz des Kaufmanns Jüterbogk übergegangen, welcher die Hofstelle an den Geheimen Rat Rindheim veräußerte und und sich selbst an der Panke (wo heute das Restaurant Pankgraf ist) einen Sommersitz erbaute. Rat Rindheim verkaufte den Hof an den Bankier Behrendt. (Breite Str. 12.)
Noch eine Episode dieses Jahrhunderts möge hier berichtet werden, ein Dorfstreit, welcher sich neben dem traurigen und in seinen Folgen so schweren Siebenjährigen Krieg wie ein Stücklein Humor mitten in ernster Zeit ausnimmt. Es war ein Krieg um das Bier und um das Krugrecht.
Welches Bier wurde in Pankow getrunken? Diese Frage erscheint wahrhaftig recht gleichgültig und doch wurde sie zu ihrer Zeit im engen Dorfleben viel besprochen und mußte vom König schließlich entschieden werden. Darum möge neben allem Ernsten auch dieses heitere Stückchen der Geschichte[7] hier einen Platz finden. Pankow war 1370 bis 1548 ein Stück des Besitzes Berlins. Daher war es ein Recht der Brauereizunft Berlins, daß ihr Bier allein hier im Krug verzapft und getrunken wurde. Als von Grumbkow 1680 den „freien Rittersitz“ Nieder-Schönhausen, das Gut Pankow und Blankenfelde kaufte, erwarb er auch die Brauereigerechtigkeit in Blankenfelde und die Zusage, daß er berechtigt sein soll, „seine Güter und Dörfer Sumt, Blankenfelde Nieder-Schönhausen und Pankow“ mit dem in Blankenfelde gebrauten Bier zu versorgen, „während diese Güter zu der Stadt Berlin Ziese Städter vor diesem gehört haben und daher das Bier auch aus selbiger Stadt nehmen müssen“.Darin lag für den Gutsherrn eine bedeutende Einnahme, denn seine Brauerei brachte dadurch höhere Pacht. Es erscheint uns in unserer Zeit recht eigentümlich, daß dem Krugwirt einfach befohlen wird, statt von Berlin nun von Blankenfelde das Bier zu beziehen. Was sagten die Berliner dazu, welche hier wohnten oder gerne schon damals zu dem schönen Pankow ihre Ausflüge machten? Sie wollten im Schatten der Bäume natürlich Berliner Bier trinken. So war seit 1726 ohne amtliche Anfrage und Genehmigung im alten Amtshaus ein Ausschank von „fremden“, d. h. Berliner Bier erstanden. Der Krugwirt schwieg dazu, denn er hatte auch „zum besseren Accomodement der Passagiere“ gegen die Bestimmung fremde Biere und Wein ausgeschenkt, damit aber der Pächter der Brauerei in Blankenfelde auch schwieg und nicht zu Schaden kam, diesem neben den drei Talern Zapfgeld an das amt jährlich 30 Taler Entschädigung gegeben. Nun wollte die Frau Leutnant Falk 1751 für das Amtshaus die direkte Erlaubnis zum Ausschank fremder Biere und zur Bewirtung der Gäste auf „der Insel“ haben. Dagegen protestierte nun der Krugwirt und der Pächter der Amtsbrauerei. Schulzen und Schöffen wurden vernommen und viel berichtet und geschrieben. Obwohl der Bruder der Frau Leutnant Falk, der Kammerdiener Möhring, 150 Taler bot, entschied der König 1752, daß der Ausschank im Amtshause ganz unterbleibe, und daß der Krug des Ortes nur das Blankenfelder Amtsbier ausschenke.[8] Selbst im Kaufkontrakt zwischen von Grumbkow und Friedrich III. wird diese Gerechtsame der Blankenfelder Brauerei bestätigt. Wir hören bei dieser Gelegenheit, daß den Krughof damals die Regimentsquartiermeisterin Witte und seit1752 Frau Marianne von der Lahr besaß. Der Krug selbst wurde verpachtet, und nennt das Kirchenbuch manchen Krüger. So war diese Rivalität und die Bierfrage erledigt. Der Krug war mit einem Bauernhof verbunden, und dieser war das heutige Grundstück Linder (in der Breiten Straße 36.)
Pfarrer dieses Jahrhunderts waren nach Ideler, welcher 1729 starb, Gottfried Stockfisch bis 1761,Christoph Corthym bis 1766, Daniel Roth bis 1777, Samuel Hitzwedel bis 1814. Küster und Lehrer waren Georg Frehde 1701-06, Bogislav Matz, ein Schneider, 1706-52, Johannes Gottfried Palm 1752-86, welcher 1822 pensioniert starb, und dessen Sohn Gottfried Palm 1786 bis 1812. Ortsschulzen waren Christoph Müller seit 1691, ihm folgten Martin Grunow bis 1752, dann Martin Wartenberg 1752-79, wieder ein Martin Grunow 1779 bis 1827.
Die bauernfamilien am Ende des Jahrhunderts hießen Müller, Soldmann, Borchert, Lidemit, Pieper, Zwarg, Bogel, Zernikow, Grüne, Jauert, drei Grunow und Wegener. Einige Bauernfamilien waren erloschen, die Puhlmann, Krafft, Schaum, Ohm, Calies, Wartenberg, Bruseberg, Liebnitz. Pankow hatte 1800 nach Bratings Aufzeichnungen[9] 286 Einwohner, 15 Bauernhöfe, 10 Kossätenhöfe, welche aber bis auf einen Wirtschaftshof Sommersitze waren, 3 Büdner, 9 Gärtner, 19 Einlieger; es gehörte zum Justiz- und Oekonomie-Amt Schönhausen und bildete mit Schönhausen und Schönholz und Blankenfelde eine Parochie unter der Superintendentir Berlin (Nicolaikirche).
Vieles hatte sich im Lauf des Jahrhunderts im Ort geändert. Das bedeutsame Wahrzeichen der alten Zeit, das Lehnsgut, auf dem die Duseke, Blankenfelde, Kurfürst und Könige gesessen haben, war geteilt und verfallen, aber mancher Bauernhof ernährte noch dieselbe Familie. Nachweislich seit 1696, aber gewiß schon viel länger, saßen die Zwarg, Liedemit, Grunow und Liebnitz auf ihrem Hof, seit 1750 die Borchardts als Bauern, aber schon früher als Kossäten. Der Kossätenhof der Borchardts scheint nach einer Vernehmung von 1806 zwischen Amalienpark und Wegener in ältester Zeit gelegen zu haben und ist wahrscheinlich vom Besitzer des Kossätenhofes, Herrn Amtshauptmann von Stosch, annektiert worden. Auch Steeger wird erwähnt. Noch ein Zeuge der alten Zeit war im Ort. In der Mitte desselben stand noch das alte Kirchlein. Den Granitbau hatten die Stürme der Jahrhunderte nicht vernichten können. Mehr als 500 Jahre hatte sie überdauert. Vor dem Altar der alte Tauftisch, den einst der Patron Berchelmann geschenkt hatte, dessen Namen und Wappen die Altarfenster noch trugen; auf dem Altar der ehrwürdige Kelch von 1604, den wir heute noch haben, auf dem Tauftisch das alte Taufbecken, herrlich gearbeitet, mit seiner rätselhaften Inschrift; auf der kleinen Empore seit 1710 die winzige Orgel mit nur drei Zügen, welche einst in der alten Luisenkirche zu Berlin den Gemeindegesang geführt hatte und hierher durch Verkauf versetzt war; vom Turm riefen die drei Glocken, die älteste seit 1475, die zweite seit 1556. In diesem Kirchlein waren die Vorfahren gepilgert, hier waren alle getauft, konfirmiert und getraut; hier lagen im Schatten der Kirche, von der Kirchhofsmauer eingeschlossen, die Vorfahren. Nur der Turm war schwach und müde geworden. 1737 hatte ihn ein Sturm scharf erschüttert, einige Planken abgerissen und den oberen Teil heruntergeweht. Dadurch mußte wohl auch das Dach der Kirche stark gelitten haben, so daß eine größere Reparatur unvermeidlich war, welche 1777 beendet wurde und 129 Taler verursacht hatte.[10] Schon damals wurde anerkannt, daß der Turm stark baufällig war. Er mußte im Anfang des neuen Jahrhunderts abgetragen werden;; die ersten Jahre sollte er noch sehen, wohl die schwersten, welche er je erlebt hatte.
Auch das Pfarrhaus, über das Pfarrer Stockfisch 1759 schon geklagt und das er durch den Anbau eines Zimmers auf seine Kosten vergrößert hatte, mußte 1792 gründlich repariert werden. Die Fundamente und Lehmfachwände wurden teilweise erneuert und der kleine eingefallenen Stall 1800 neu errichtet. Des Küsters Haus war ganz verfallen und wurde 1797 niedergerissen. Der Neubau des ganzen Hauses kostete 328 Taler. Man baute billiger als heute, aber auch sehr anspruchslos. Den Lehm zu den Fachwänden holte die Gemeinde vom Feld, das Holz, welches der Patron unbehauen gab, holte sie von der Försterei, zum Dach lieferte jeder einen Anteil am Stroh und die Arbeitslöhne trugen alle Höfe gemeinsam. Das waren für die Gemeinde, welche hohe Steuern zahlte, große Ausgaben, denn die Hofbesitzer waren selbst arm. In den Abschätzungen, welche von allen Höfen genau erfolgten, heißt es bei jedem Hof, daß die Häuser und Ställe baufällig seien und der Reparatur sehr bedürfen; alle Häuser waren ohne Keller, Lehmfachbau und mit Stroh gedeckt.
[1] A. M., Akten.
[2] A. M.
[3] St. G. K., Tit. LXXIII. Sekt. c., Nr. 14
[4] Amt Mühlenhof.
[5] Ebendaselbst.
[6] A. M.
[7] St. G. K., Tit. LXXIII. Sekt. c., Nr. 6
[8] St. G. K., Tit. LXXIII. Sekt. d., Nr. 3
[9] Brating, „Mark Brandenburg“.
[10] A. M.
